Verbände feiern 60 Jahre GALK
Im Rahmen des sechzigjährigen Jubiläums der Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) fand letzte Woche der jährliche Bundeskongress der Fachverbände statt. Unter dem Thema „Neue Wege im Grünflächenmanagement“ wurde den Teilnehmern in Frankfurt am Main ein vielfältiges Programm geboten, die trotz drückender Hitze angeregt diskutiert wurden.
- Veröffentlicht am

Unter der gekonnten Moderation von Mechthild Harting, Journalistin der FAZ, ging die Vortragsreihe am Freitag los, nachdem am Tag zuvor die Mitgliederversammlungen der einzelnen Verbände stattfanden.
Nach einer kurzen Einführung durch Götz Stehr, dem Präsidenten der GALK, ergriff Alexandra Chmielewski, Umweltdezernentin der Stadt Frankfurt, das Wort. In ihrer Begrüßungsrede wies sie auf den hohen Stellenwert des städtischen Grüns in Frankfurt hin. Die Unterhaltung der Flächen sei jedoch die Raupe Nimmersatt in den Kassen der Grünflächenämter. Chmielewski hob daher vor allem die Bedeutung einer Prozessoptimierung und Steuerung des Managements in den Vordergrund, um angesichts des knappen Budgets trotzdem den Wert der Grünflächen zu steigern und auch den Ansprüchen der Bürger an „ihre“ Grünflächen gerecht zu werden.
Den Faden der Prozessoptimierung griff der Leiter des Frankfurter Grünflächenamtes, Stephan Heldmann, in seinem anschließenden Vortrag auf. Er zeigte, dass die Stadt durchaus durch an einer Prozessoptimierung arbeitet, beispielsweise durch die Einführung einer digitalen Zeiterfassung in der Grünflächenpflege. Trotzdem steigt der finanzielle Druck auf das Amt, betont Heldmann: Obwohl die Bevölkerung Frankfurts deutlich wächst und auch mehr Wohnungen und Grünflächen entstehen, entspricht der Personalzuwachs dieser Entwicklung bei weitem nicht. Zugleich entstehen Nutzungskonflikte, vor allem wenn „Wiesen für Insekten“ die „Wiesen für Menschen“ ersetzen. Der Gartenamtsleiter sucht daher gezielt den Austausch mit den Bürgern, aber auch mit den anderen Ämtern: „Nur wenn wir vernetzt denken und ein Gesamtmanagement entwickeln, können neue Potenziale und Ideen entstehen.“
Um Ideen, sogar um Visionen, drehte sich auch der anschließende Vortrag des Landschaftsarchitekten Prof. Rainer Schmidt aus München. In seinen Entwürfen stehen vor allem die Nutzer im Fokus. „Wir haben Wissensarbeiter in unseren Städten!“, betont Schmidt. Diese Menschen suchten auch nach einer kulturellen Identität des Ortes. Wo sich aber viele verschiedene Ansprüche an eine Freifläche überlagerten, müssen neue Synergien geschaffen werden. „Stadtzentren sind eine moderne Allmende, auf der viele Nutzungen stattfinden. Eine hohe Dichte muss Grün nicht ausschließen.“ Daher denkt er über neue Visionen für Grün in der Stadt nach. „Stadtgrün kann auch nutzbar sein“, führt Schmidt seine Ideen aus. Er hält sogar eine Biomasseproduktion in der Stadt mit Monopflanzungen aus Miscanthus für möglich. Durch die flächige Pflanzung des Ziergrases entstehe ein ruhiger, fast meditativer Ort, und gleichzeitig könne das jährlich anfallende Schnittgut noch effektiv zur Energiegewinnung genutzt werden. Auch Baumschulflächen als öffentlich zugängliche Grünflächen sind für Schmidt eine Alternative zu „herkömmlichen“ Parks im urbanen Raum.
Weniger visionär, aber ebenso innovativ ist der Weg Saarbrückens im Umgang mit Grünflächen. Für Monika Kunz, Leiterin des Stadtplanungsamtes Saarbrücken, steht die integrierte Stadtentwicklung im Fokus. Die saarländische Landeshauptstadt verfolgt dabei einen neuen Weg, um funktionierende Freiraumkonzepte zu entwickeln: Auf Basis des städtebaulichen Entwicklungskonzept bildete die Stadt eine dezernatsübergreifende Arbeitsgruppe, die in wissenschaftlicher Begleitung Fachkonzepte erstellte, aus denen wiederum integrierte teilräumliche Konzepte abgeleitet werden konnten. So wurden Handlungsräume erkannt und bearbeitet. „Natürlich läuft das nicht ohne Probleme ab, aber man muss intensiv über Ziele und Prioritäten diskutieren“, meint Kunz. Nur ein einer solchen „Kultur der guten Zusammenarbeit“ könne ein gemeinsamen Optimum gefunden werden.
Auch Berlin hat nach einer solchen Verknüpfung der verschiedenen Interessen gesucht, die Lösung ist jedoch eine völlig andere. Gabriele Pütz stellte das Handbuch „Gute Pflege“ vor, dass sie mit ihrem Büro in zwei Jahren intensiver Arbeit und ebenso intensivem Austausch mit allen Beteiligten entwickelt hat. Ziel war, auch aufgrund des steigenden Nutzungsdrucks auf den Flächen für alle zwölf Bezirke Berlins eine gemeinsame Argumentationsgrundlage für die Finanzierung der Pflege zu schaffen.
Dazu soll das GRIS, das bereits bei den meisten Bezirken Einsatz findet, künftig in allen Bezirken zum Einsatz kommen. Im GRIS ist bereits eine Einteilung in verschiedene Flächentypen enthalten. Bei der Erarbeitung des Handbuchs galt es nun, diese auch mit den Biotoptypen in Einklang zu bringen, die der Naturschutz verwendet, und eine gemeinsame Arbeitsbasis zu entwickeln. Diesen Flächentypen konnten dann Funktionsprofile zugeordnet werden, die abbilden, ob eine Fläche vorwiegend eine ästhetische, ökologische oder soziale Funktion erfüllen muss. Nur so können dann klare und einheitliche Pflegestandards und Maßnahmen abgebildet werden, mit denen sowohl die Planwerke als auch die Ausschreibung von Pflegearbeiten erleichtert wird. Wesentlich ist Pütz zufolge aber auch die Argumentationsgrundlage, die das Handbuch für die Rechtfertigung von Kosten gegenüber der Politik bietet. „Wenn Sie die Fläche in einem bestimmten Zustand halten wollen, müssen sie auch Geld in die Hand nehmen.“ Mit dem Handbuch wird dieser Argumentationsstrang nun hoffentlich auch für die Politiker nachvollziehbar.
Nach der Mittagspause half Prof. Martin Thieme-Hack, Vizepräsident der FLL, den Kongressteilnehmern gekonnt und wie gewohnt unterhaltsam über das drohende Mittagstief hinweg. Auch er stellte ein Buch vor: den Bildqualitätskatalog Freianlagen. Seinen Vortrag leitete Thieme-Hack mit der Frage ein, was denn eigentlich Qualität sei. „Für den Mieter ist vielleicht gerade der Bubikopfschnitt Qualität!“ Zugleich sei es bei den meist inputorientierten Leistungsbeschreibungen schwierig, dem Unternehmer klar zu vermitteln, was eigentlich zu tun sei. Mit dem Bildqualitätskatalog gibt es jedoch eine neue Alternative, die dem ausführenden Unternehmen mehr Freiheiten und Kreativität einräumt und zugleich Missverständnisse verhindert.
Der Katalog gibt für eine große Bandbreite an grünpflegerischen Maßnahmen unterteilt in fünf Servicelevel auf Basis von Fotos die Ziele der Leistungsbeschreibung wieder. Damit kann auch ohne Fachkenntnisse klar definiert werden, welcher Servicelevel angestrebt wird. Auf welchem Weg das ausführende Unternehmen diese Zielvereinbarung erreicht, bleibt ihm überlassen, Streitigkeiten ob der Erreichung des angestrebten Bildes jedoch entfallen.
Dabei wird das Unternehmen nicht, wie bisher üblich, nach Pflegedurchgängen bezahlt, sondern nach Wochen. „Das erfordert vom Unternehmer natürlich mehr Kreativität, mehr „brain“, wie er seinen Auftrag erfüllt“, führt Thieme-Hack aus. Die Kontrolle bei diesem Verfahren erfolgt punktuell und bietet die Möglichkeit zur direkten Rückkopplung zum Unternehmer.
Wesentlich theoretischer gestaltete sich das Thema Markus Gnüchels, der über den Leitfaden Nachhaltigkeit von Freianlagen referierte, der derzeit bei der FLL entwickelt wird. Er soll der Herstellung von Zuverlässigkeit von Freianlagen dienen. Der Arbeitskreis entwickelte dabei ausführliche Prüfblätter und Kommentarbögen, in denen die Qualität eines Raumes unter anderem unter ökologischen, ökonomischen, sozialen und technischen Gesichtspunkten untersucht wird. Daraus ergibt sich ein Erfüllungsgrad, der eine Aussage über die Nachhaltigkeit der jeweiligen Fläche gibt.
Prof. Cassian Schmidt spannte anschließend wieder den Bogen zu den Bepflanzungsideen, die Prof. Rainer Schmidt am Vormittag vorstellte. Mit seinen Ansätzen zur Staudenverwendung im öffentlichen und halböffentlichen Raum weicht er deutlich von der flächenhaften Verwendung einzelner Arten ab, die der Landschaftsarchitekt vorgestellt hatte, und bezog klar Stellung für eine artenreiche und vor allem bunte Optik von Grünflächen. „Wir pflanzen vorrangig für Menschen“, betont Cassian Schmidt. „Ich sehe den landschaftsarchitektonischen Ansatz eines Professor Schmidt, aber ob das Lieschen Müller gefällt?“ Für seine Kritik an den Entwürfen erntete er deutlichen Applaus aus dem Publikum.
Schmidt gibt aber auch zu, dass abwechslungsreiche Pflanzungen nicht pflegeleicht sind. Er betont sogar, dass auch die von Experten entwickelten und erprobten Staudenmischungen nur von ausgebildeten Gärtnern dauerhaft gepflegt werden können. „Staudenpflanzungen verhalten sich gerne anarchisch“, veranschaulichte der Staudenexperte. Zum dauerhaften Monitoring seien entsprechende Pflanzenkenntnisse nötig. Der Stress, der durch die Ausmagerung des Substrates bei Staudenmischungen künstlich erzeugt wird, senke den Pflegeaufwand aber erheblich. Es müsse aber schon in der Planung darüber nachgedacht werden, wer im Nachgang pflegt und welche Maschinen dafür zur Verfügung stehen.
Als Alternative zu Staudenpflanzungen und Staudenmischungen stellte Cassian Schmidt auch den Ansatz des Coppicing vor, bei dem Gehölze mit spannenden Blattfarben und –texturen in Ergänzung zu den Stauden eingesetzt und jährlich heruntergeschnitten werden. „Da können sich die Bubikopf-Gärtner richtig austoben“, greift er schmunzelnd den Vortrag seines Osnabrücker Kollegen Thieme-Hack wieder auf. „Allerdings habe ich schon Angst, dass bald alles einfach runtergeschnitten wird, auch Amelanchier und Co. Das ist wie bei den Splittpflanzungen. Da werden jetzt in Vorgärten auch ganz viele angelegt, nur die Pflanzen werden dabei vergessen.“
Ebenfalls mit dem Thema Grün beschäftigt sich der Schwede Olle Markusson. Als Vertreter der Marke Husqvarna stellte er die Vorteile des Einsatzes von Mährobotern auch im öffentlichen und halböffentlichen Grün vor. Seit 2008 steigt der Anteil der Automower bei den verkauften Geräten immer mehr an, und Deutschland ist einer der größten Abnehmer. „Der Unterschied zum herkömmlichen Mähen ist, dass Sie nicht hohes Gras abschneiden, sondern flaches Gras flach halten“, erläutert Markusson. Damit könnte ein wesentlich dichteres und gleichmäßigeres Schnittbild erzielt werden, gleichzeitig sei die Lärmemission äußerst gering, und aufgrund des Elektromotors gibt es auch keine schädlichen CO2-Emmissionen. Der ständig gemähte Rasen sei zudem weniger krankheitsanfällig und von weniger „Spontanvegetation“ durchsetzt. Dabei wird großer Wert auf die Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards gelegt, das Verletzungsrisiko sei so wesentlich geringer als bei herkömmlichen Mähern.
Den letzten Vortrag des Tages brachte Christian Wieland aus dem schweizerischen Winterthur. Gemeinsam mit dem Städten Ecublens und Luzern war Winterthur eine der Pilotstädte für die Entwicklung des Labels „Grünstadt Schweiz“, mit dem zukünftig Kommunen zertifiziert werden sollen, die besonders viel in die Qualität ihrer Grünflächen investieren. Jeder Bewerber erhält dabei während des Zertifizierungsprozesses 60 Maßnahmenblätter, deren Anforderungen es zu erfüllen gilt. Diese beziehen sich nicht nur auf die Grünflächenpflege selbst, sondern bilden beispielsweise auch Führungsprozesse ab. Bei erfolgreicher Durchführung der Maßnahmen wird das Label dann in den Stufen bronze, silber und gold vergeben. Nach 4 Jahren kann eine Re-Zertifizierung erfolgen, bei der die teilnehmende Stadt oder Gemeinde auch ihren „Rang“ verbessern kann.
Den Abschluss des Bundeskongresses bildeten drei Exkursionen am Samstagvormittag. Die Teilnehmer konnten entweder den gartendenkmalpflegerisch sehr spannenden Grüneburgpark direkt am bekannten Palmengarten der Stadt Frankfurt besichtigen, oder an Führungen am Frankfurter Hauptfriedhof sowie durch den neuen Hafenpark der Mainmetropole teilnehmen.
Durch den Grüneburgpark führte Barbara Vogt, eine Expertin auf dem Gebiet der Gartendenkmalpflege. Die weitläufige, überwiegend im Stil des englischen Landschaftsparks gestaltete Anlage entstand ursprünglich als Privatpark der Familie Rothschild um deren Palais. Erst während des Naziregimes fand dann durch Entziehung ein Besitzerwechsel statt. Seit den 1950 ist der Park als Volkspark öffentlich nutzbar; eine der wesentlichen Herausforderungen der Stadt ist heute, den starken Nutzungsdruck mit dem gartendenkmalpflegerischen Anspruch zu verbinden.
Die Führung über den 1828 eröffneten Hauptfriedhof übernahm Christian Setzepfand. Auf dem inzwischen 70 Hektar großen Friedhof sind zahlreiche bekannte Persönlichkeiten beerdigt. Besonders beeindruckend unter dem landschaftsarchitektonischen Aspekt ist hier der Altbaumbestand im ältesten Bereich des Friedhofs.
Ganz jung dagegen ist der Hafenpark, der erst vor drei Jahren eröffnet wurde. Stephan Heldmann führte durch die moderne Anlage, die mit multifunktionalen Sport-und Spielfeldern, einem der größten Skateparks Deutschlands, Fitnessanlagen und Spielplätzen für jede Altersgruppe attraktiv ist. Bald wird hier auch das Mainufer mit dem Frankfurter Grüngürtel verbunden sein, was die Attraktivität des Ortes weiter steigern soll. Einen Nachteil hat das sportliche Ambiente aber: Heldmann berichtet, dass fast jede Woche ein Krankenwagen nach einem Skate-Unfall hierher ausrücken muss.
Diese drei Exkursionen spiegelten genau wie die Vorträge die Vielfalt wider, mit der sich Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner im städtischen Raum auseinandersetzen müssen. Vielleicht noch wertvoller als der rein fachliche Inhalt war aber der Austausch zwischen Landschaftsarchitekten und „Grünflächenmanagern“, denn, wie die Referenten mehrfach erwähnten, nur durch diese Vernetzung können neue Impulse entstehen.





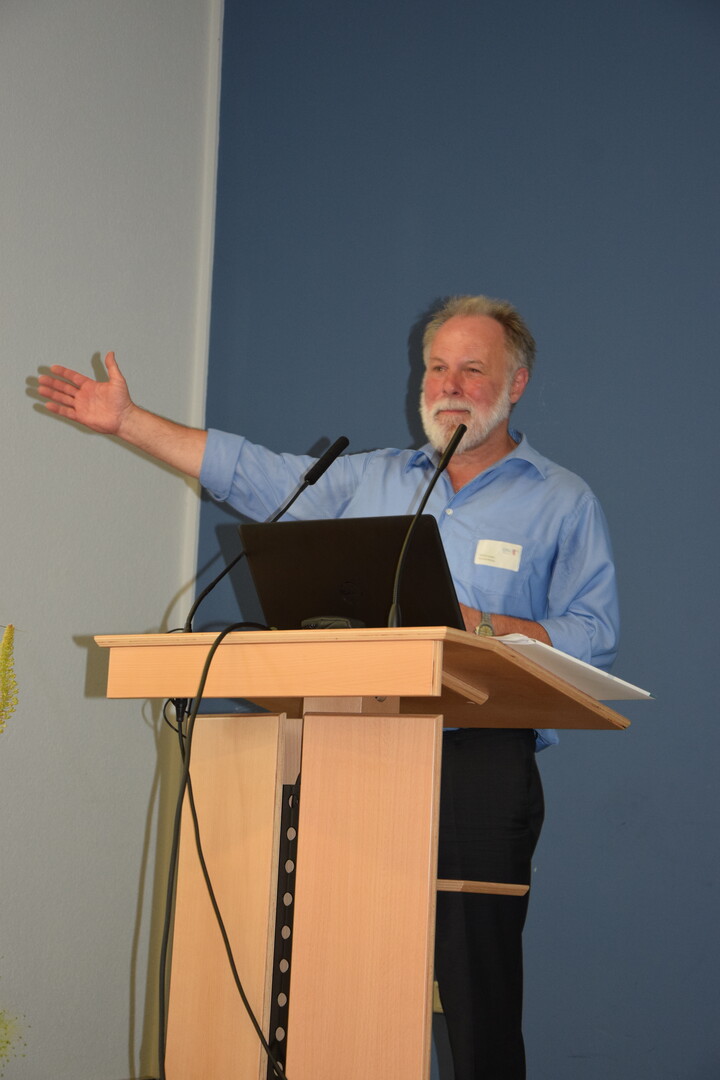







Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.