Nachhaltige Bauabwicklung im Mittelpunkt
Zum Thema „Nachhaltige Bauabwicklung – Umweltschutz auf der Baustelle“ wurde die 17. Landschaftsbautagung an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf zum ersten Mal digital abgehalten. Die sechs Referenten haben das Thema der nachhaltigen Bauabwicklung aus sehr unterschiedlichen Bereichen beleuchtet und die Tagungsteilnehmer zu vielschichtigen Diskussionsrunden angeregt.
- Veröffentlicht am
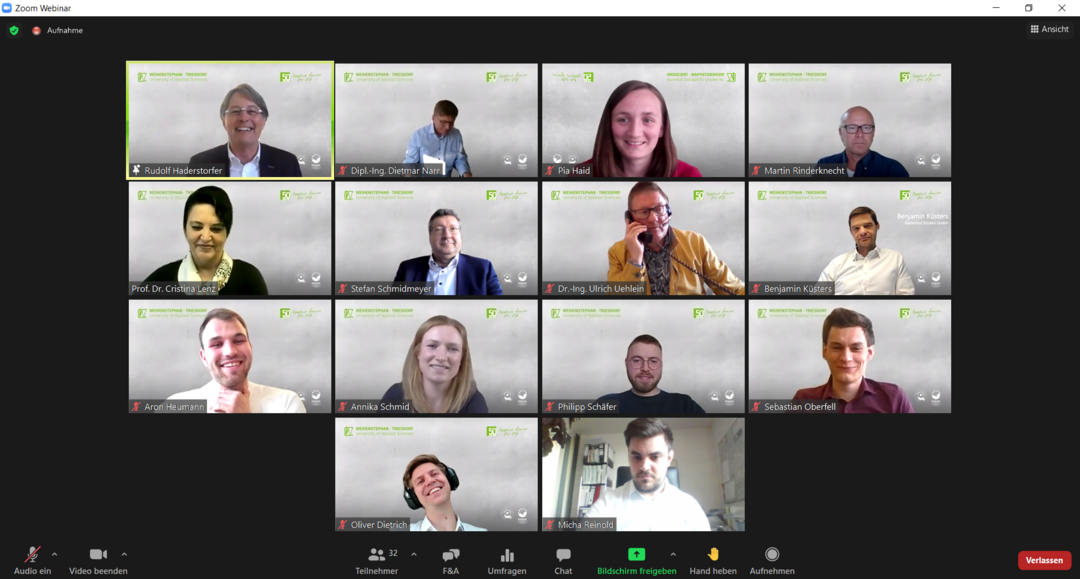
Erfahrungen und Bewertungen zu alternativen Energien und Antrieben
Prof. Dr. Thomas Brunsch, der an der HSWT die Professur für Technik und Bauabwicklung im Landschaftsbau inne hat, hielt den Eröffnungsvortrag zum Thema „Nachhaltige Maschinentechnik“. Seiner Einschätzung nach befindet sich die Fahrzeugtechnik inmitten einer ELICOSS-Disruption, die maßgeblich vom Autobauer Tesla vorangetrieben wird: Der breite Einzug von elektrischen Antrieben sei demnach im Segment der PKWs nicht mehr aufzuhalten und der Verbrennungsmotor wird nahezu gänzlich vom Markt verdrängt werden. Hauptgrund hierfür ist die Einsparung von CO2-Emissionen, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten oberste Priorität hat. Der Einsatz der Wasserstofftechnologie ist laut Professor Brunsch für kompakte Geräte nicht sehr erfolgsversprechend. Sie wird in Zukunft eher im Segment der Schwertransporte, Schwermaschinen und im Flugverkehr eingesetzt werden. In Bezug auf Baumaschinen bleibt die beschriebene Disruption bislang noch aus, ist aber greifbar nahe. Bezüglich der Emissionseinsparung haben Baumaschinen ein sehr hohes Potenzial. So kann beispielsweise bereits ein einziger E-Bagger bis zu 32 t CO2 pro Jahr einsparen, das entspricht der CO2-Last eines Vier-Personen-Haushalts.
Professor Brunsch berichtete von persönlichen Erfahrungen mit E-Baumaschinen, die er im Rahmen eines Studienprojektes auf der Landesgartenschau Ingolstadt machte. Im praktischen Einsatztest ergaben sich positive und negative Aspekte für die verschiedenen Baumaschinen - eine grundsätzliche Eignung ist durchaus vorhanden. Insbesondere im Bereich lärm- oder abgassensibler Arbeiten haben sie schon heute ihre Daseinsberechtigung.
Ein Thema, das im Anschluss an den Vortrag diskutiert wurde, ist die Stromversorgung auf Baustellen. Diese stellt gerade bei öffentlichen Bauvorhaben leider oftmals ein Problem dar. Bei privaten Auftraggebern hingegen kommt der Einsatz von E-Maschinen oft besonders gut an. So berichtete ein Teilnehmer von der Erfahrung, dass bei der Bitte um einen Stromanschluss viele Kunden den Strom sogar kostenfrei zur Verfügung stellen würden. Immer wieder zeigt sich: die Erreichung des Ziels einer stark emissionsreduzierten Baustelle erfordert Flexibilität und Kreativität auf allen Seiten.
Umweltgerechte Bauabwicklung – Handlungsempfehlungen
In seinen sehr kurzweiligen Vortrag zum Thema umweltgerechte Bauabwicklung ließ M.A. Benjamin Küsters unter anderem seine Erfahrungen als GaLaBau-Unternehmer einfließen.
Die „Umweltgerechte Bauabwicklung“ umfasst viele Teilaspekte, die es zu gewichten und zu berücksichtigen gilt. Verhältnismäßig einfach zu handhaben, sind beispielsweise die Artenschutzverordnungen, die die Schnittzeiten von Hecken und Gehölzen regeln, damit Wildtiere und Vögel in ihren Winterruhe- und Brutzeiten nicht gestört werden. Hierfür empfahl Herr Küsters das Informationsmaterial der Galabau-Verbände für ihre Mitgliedsbetriebe. Die Wiederverwendung von Materialien - etwa der Einbau von Recyclingmaterialien - ist ein weiterer wichtiger Baustein im Sinne einer umweltgerechten Bauabwicklung. Hier ist die Umsetzbarkeit in der Praxis leider nicht unbedingt so gegeben, wie es wünschenswert wäre. So macht beispielsweise der bürokratische Aufwand zur Verwendung von Recycling-Materialien diese als nachhaltige Baustoffe oftmals unnötig teuer. Der Einsatz elektrifizierter Baumaschinen ist ein weiterer Aspekt. Hier berichtete Herr Küsters von einer Untersuchung der Arbeitsgruppe des VGL NRW, die sehr gute Erfahrungen mit E-Baumaschinen gemacht hat.
Insgesamt ist die Offenheit für neue Denk- und Arbeitsweisen sowie das konzeptionelle Zusammenwirken aller Projektbeteiligten von entscheidender Bedeutung, um eine umweltgerechte Bauabwicklung aktiv zu ermöglichen. Aus Sicht von Herrn Küsters sind hier bürokratische Vorgaben und hochkomplexe Projektsteuerungstools nicht zielführend, vielmehr muss eine umweltgerechte Bauausführung „einfach“ wieder Teil des Arbeitsethos sein, gerade bei den Landschaftsgärtnern.
Der Umgang mit Boden
Durch den dritten Vortrag der Landschaftsbautagung führte dieses Jahr Herr Stefan Schmidmeyer, der sich mit dem Thema „Der Umgang mit Boden - konkrete Empfehlungen zur Wiederverwendung und Entsorgung“ befasste. Zu Beginn erläuterte Herr Schmidmeyer die Definition von Bodenaushub und den aktuellen Umgang in Bezug auf die Thematik „Entsorgung“. Der aktuelle Stand der Entsorgung sieht laut Herrn Schmidmeyer erschreckend negativ aus, da ein Großteil des Bodenaushubs in Verfüllungen oder Deponien entsorgt wird und lediglich ein Bruchteil (ca. 10%) wieder verwertet wird. Im Anschluss zeigte Herr Schmidmeyer auf, inwieweit Bodenaushub in den verschiedenen Bereichen der Baubranche zum Einsatz kommen kann, ohne entsorgt werden zu müssen.
Den Vortrag stütze Herr Schmidmeyer zudem auf fünf grundsätzliche Fragen bzgl. Bodenaushub: Die erste Frage befasste sich damit, ob der Bodenaushub dem Abfallrecht unterliegt oder nicht. Die nachfolgende Frage behandelte die Thematik, ab wann eine Untersuchung notwendig ist. Sie bedingte zeitgleich auch die Frage Nummer drei: „Wie muss ich den Boden (-aushub) untersuchen?“. Im vierten Punkt gab Herr Schmidmeyer zudem noch seine Empfehlungen zur Wiederverwendung und Entsorgung ab und stellte in der abschließenden Frage dar, welche Auswirkungen der aktuelle Umgang mit Boden in der Zukunft haben wird.
Umweltbaubegleitung – Bedeutung und Inhalte
Zum Thema der Umweltbaubegleitung referierten Dr. Ulrich Uehlein und Landschaftsarchitekt Dietmar Narr. Dr. Uehlein ist Leiter des Teams Grüngutachten der LH München im Referat für Stadtplanung und Bauordnung, das mit 6500 Baugenehmigungen jährlich Deutschlands größte Baugenehmigungsbehörde ist. Knapp 30 Prozent davon sind Baufälle mit „grünen Belangen“. Das Team Grüngutachten hat dabei die Funktion der Umweltbaubegleitung inne. Mit der UBB in der Stadtpolitik sollen der Baumschutz und die Freiflächengestaltungssatzung verstärkt berücksichtigt werden. Die Regelungen im Baugenehmigungsverfahren machen die Begründung nach einem rechtlichen Verlangen einer UBB allerdings schwierig. Eine UBB kann daher nur bei sehr bedeutsamen oder schwer umsetzbaren naturschutzrechtlichen Auflagen gefordert werden. Im Genehmigungsbescheid wird daher als Hinweis auf eine freiwillige UBB verwiesen, wenn beispielsweise Artenschutzmaßnahmen erforderlich sind oder bautechnisch sehr anspruchsvolle Bauabwicklungen durchgeführt werden. Die Tätigkeiten der UBB sind unter anderen die Auswertung und Übersetzung von Auflagen und Hinweisen aus der Genehmigung, Kontrollgänge auf den Baustellen und die Dokumentation in Text und Bild. Abgerundet wurde der Vortrag von Herrn Dr. Uehlein durch spannende Einblicke in den praktischen Berufsalltag des Umweltbaubegleiters in München.
Dietmar Narr ist als Landschaftsarchitekt BDLA und Stadtplaner ByAK sowie als Moderator für Stadtentwicklung VHW ebenfalls in der Umweltbaubegleitung tätig und Mitinhaber der NRT Bürogemeinschaft in Marzling. Er betonte in seinem Vortrag die zunehmende Bedeutung der UBB in den letzten Jahren. Die Umsetzung von umwelttechnischen und naturschutzrechtlichen Auflagen der Genehmigungsbehörde erfordern umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen der Biologie und der Bautechnik, sodass die Instanz der UBB erforderlich wird. Dabei gibt es Schnittstellen der UBB als Bestandteil des Naturschutzes zu den Aufgabenfeldern der Bauleitung, etwa beim Einhalten von DIN-Normen, und zum Technischen Umweltschutz, hier beispielsweise im Bereich des Boden- und Gewässerschutzes. Zu der Verteilung der Zuständigkeiten gibt es allerdings keine verbindlichen Regelungen, sodass diese projektspezifisch mit dem Bauherrn zu vereinbaren sind. Auch Herr Narr präsentierte zum Abschluss einige Praxisbeispiele: Dazu gehörte der Bau eines Staubschutzzauns zum Schutz eines angrenzenden FFH-Gebiets, das Aufstellen einer temporären Sperreinrichtung für Amphibien in der Bauphase oder der Neubau eines Ersatzhorts für Schwarzstörche.
Kunstrasen – quo vadis: Die Diskussion um Mikroplastik
Der letzte Vortrag „Kunstrasen – quo vadis: Die Diskussion um Mikroplastik“ wurde von Martin Rinderknecht gehalten. Er ist unter anderem zertifizierter und geprüfter Sicherheitsexperte und Sportplatzprüfer für die Schweiz, Österreich und Deutschland. Im Gegensatz zu Naturrasen haben Kunstrasenfelder durch die ganzjährige Bespielbarkeit und die Möglichkeit hoher Nutzungsstunden einen entscheidenden Vorteil. Während Naturrasen maximal 900 h/Jahr genutzt werden können, können Kunstrasen über 1300 bis 1600 h Spielbetrieb/Jahr aufnehmen. Der bedeutende Nachteil der Kunstrasen ist dagegen der Austrag von Mikroplastik. Nach der Erfahrung von Herrn Rinderknecht beläuft sich dieser auf jährlich ca. 2,2 Tonnen pro Feld. Zurückführen lässt sich dieser zu einem Großteil auf die Kunststoffgranulate, die in die verfüllten Kunstrasensysteme eingebaut werden. Zur Reduktion von Mikroplastik sollte daher bereits vor dem Bau anhand der Nutzungsintensität abgewogen werden, ob ein Kunstrasenfeld überhaupt nötig ist. Fällt die Entscheidung auf ein Kunstrasenfeld kann durch Pflegeoptimierung, bauliche Maßnahmen (Filter- und Rinnensysteme, etc.) und alternative Füllstoffe (Teilverfüllung mit Sand, Kork, natürliche Granulate) der Austrag von Mikroplastik begrenzt werden. Eine deutlich weniger umweltbelastende Alternative stellt auch die Bauweise mit unverfülltem Kunstrasen dar. Als wichtigsten Faktor für die Beurteilung der Umweltauswirkungen wird von Herrn Rinderknecht allerdings die jährliche Nutzungszeit genannt: Vergleicht man Naturrasenfelder mit Kunstrasenfeldern in Abhängigkeit der jeweiligen optimalen Auslastung, dann lassen sich für Kunststoffrasensportfelder deutlich geringere Umweltauswirkungen pro Nutzungsstunde feststellen.
Im Anschluss an die Tagung fand eine Podiumsdiskussion mit allen Referenten statt. Zusammen mit den vielen Fragen und Anregungen von Seiten der Zuhörer bildete die Diskussion einen runden Abschluss der Tagungsreihe. Geleitet wurde die Diskussion von Herrn Prof. Dr. Haderstorfer sowie von Frau Prof. Dr. Lenz, die sowohl die Moderation als auch die Leitung der Landschaftsbautagung übernommen hatten.






Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.