
Nachkalkulation in der Pflege
Das Thema Wirtschaftlichkeit wurde im Rahmen der Expertenbriefe für die Pflege bereits mehrfach angesprochen, daher möchten wir in diesem Brief konkreter werden und auch einfache Handlungsempfehlungen geben. Frei nach dem Motto: Kalkuliert nach – Wir zeigen euch wie!
von Enrico Suchant, M. A. (Kullmann und Meinen) erschienen am 27.05.2025Wir vertreten die Meinung: Nur wer nachkalkuliert, hat die kaufmännische Kontrolle über ein Projekt und kann wirklich aus Erfahrung lernen. Im Sinne einer lernenden Organisation ist das unerlässlich. Deshalb ist die Nachkalkulation ebenso wichtig wie die Vorkalkulation. Sie ist das entscheidende Instrument, um zu überprüfen, ob die geplanten Zeiten, Kosten und Leistungen tatsächlich eingehalten wurden oder ob es Abweichungen gab. Und genau diese Abweichungen offenbaren Optimierungspotenziale, die in Zukunft direkten wirtschaftlichen Nutzen bringen können. Denn sie zeigen, wo Prozesse verbessert, Ressourcen anders eingesetzt oder Preise angepasst werden sollten.
Gerade in der Pflege, wo wiederkehrende Arbeiten ausgeführt werden, ist es unerlässlich, regelmäßig zu reflektieren:
- Haben wir bei bestimmten Arbeitsabläufen systematisch Zeitverluste? Man denke hier zum Beispiel an die Rüstzeiten – und wurden diese einkalkuliert?
- Gibt es wiederkehrende Kostenfaktoren, die in der Kalkulation nicht berücksichtigt wurden? Wie zum Beispiel Entsorgungskosten oder Maschinen?
- Stimmen unsere Erlöse noch mit dem tatsächlichen Aufwand überein oder muss nachjustiert werden?
Wir geben Ihnen folgende Empfehlungen zur Nachkalkulation an die Hand, wobei die Funktionsweise im Prinzip der eines Heizungskreislaufs ähnelt: Wird eine Temperaturabweichung zum Soll-Zustand festgestellt, muss nachgesteuert werden. Zu beachten ist dabei:
- Regelmäßig und standardisiert erfassen: Führen Sie Nachkalkulationen nicht nur bei großen Projekten oder Problemen durch, sondern regelmäßig auch bei kleineren Pflegebaustellen. Legen Sie klare Zeitpunkte und Verantwortlichkeiten fest (zum Beispiel bei jeder Abschlagsrechnung, zum Monatsende, zur Schlussrechnung).
- Einfache Werkzeuge nutzen: Nutzen Sie im besten Fall die vorhandene Branchensoftware oder einfache Excel-Vorlagen, um Ist-Daten (wie Zeitaufwand, Materialeinsatz, Fahrtzeiten) strukturiert zu erfassen und mit den geplanten Werten zu vergleichen.
- Team einbeziehen: Die besten Hinweise kommen oft von den Mitarbeitenden vor Ort. Fragen Sie Pflegekräfte regelmäßig, wo sie Abweichungen zum Plan erleben und wie diese begründet sind (lernende Organisation, hier schlummert Potenzial!).
- Maßnahmen ableiten und kommunizieren: Die Nachkalkulation bringt nur dann echten Mehrwert, wenn daraus auch konkrete Maßnahmen folgen – sei es eine Tourenoptimierung, eine Nachschulung oder eine Preisanpassung.
- Nicht zur Kontrolle, sondern zur Verbesserung: Die Nachkalkulation soll kein Kontrollinstrument im negativen Sinn sein. Vielmehr ist sie ein Werkzeug zur Qualitätssicherung, zur Entlastung der Mitarbeitenden und zur Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität.
- Umgang mit der Wertschöpfung pro Stunde: Ein wesentlicher Baustein des Projektcontrollings ist die Betrachtung der Arbeitsproduktivität. Aussagekräftige Kennzahlen in diesem Zusammenhang sind bereinigte Größen wie Wertschöpfung und Deckungsbeitrag in Bezug zu der produktiven Arbeitsstunde. Diese Kennzahlen sagen aus, wie viel wirtschaftlicher Mehrwert/Beitrag pro geleisteter Arbeitsstunde erzielt wird. Sie liefern wichtige Erkenntnisse darüber, wie effizient Personal-/Material- und Maschinenressourcen in den Pflegeprojekten eingesetzt werden.
Betrachten wir einmal die Wertschöpfung pro Stunde, da diese eingängiger ist, als mit dem Deckungsbeitrag zu hantieren: Vom Umsatz schält man die Wertschöpfung heraus, indem man die Material- und Fremdleistungskosten abzieht. Dies dürfte in der Pflege nicht allzuviel ausmachen. Die so ermittelte Wertschöpfung wird dann durch die produktiven Stunden geteilt, sodass sich die erwirtschaftete Wertschöpfung pro produktiver Stunde ergibt.
Um diese Werte sinnvoll anhand der individuellen Kostenstruktur interpretieren zu können, ist eine Plankostenrechnung für den Betrieb beziehungsweise den Leistungsbereich als Grundlage erforderlich (Soll-Zustand). Nur so lassen sich die erzielten Werte korrekt einordnen und gegebenenfalls steuernde Maßnahmen ergreifen. Insbesondere vor dem Hintergrund der wiederkehrenden Leistungen ist das existenziell wichtig. Zum einen können Fehlentwicklungen immer wieder zuschlagen und Monat für Monat beziehungsweise Jahr für Jahr für negative Ergebnisse sorgen. Andererseits steckt ja bei den wiederkehrenden Kunden eine Chance dahinter, da der Betrieb Jahr für Jahr nachkalkulieren kann und dann im nächsten Jahr nachjustieren kann. Bedeutet: Anhand geeigneter Kennzahlen wird nachgehalten, ob die Jahresziele eingehalten wurden. Für das Folgejahr wird innerhalb der Plankostenrechnung ein Ziel festgelegt. Mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit kann nun das Preisgefüge angepasst werden.
Nun könnte man annehmen, dass die bisherigen Ausführungen für die Arbeiten im Stundenlohn keinerlei Relevanz haben. Diese sind in der Gartenpflege verbreitet und gelten oft als „sichere Bank“. Allerdings kann es hier durchaus zu einer Unterdeckung kommen, da die Arbeiten sehr stundenlohnlastig sind und wenig „Beiwerk“ mitverkauft werden kann. Materialien wie Pflanzen oder Leistungsgeräte sind Ertragstreiber und nicht auf jeder Pflegebaustelle zu finden. Deshalb gilt immer: unbedingt nachkalkulieren und damit Rendite steigern!
Wir rekapitulieren einmal: Ziel ist, eine Art Regelkreislauf zu implementieren, welcher als Wohlfühltemperatur die eigene Kostenstrukur und Ziele „eingestellt“ hat. Aus der Erfahrung aus dem Berateralltag können wir berichten, dass dies gut funktioniert und solide wirtschaftliche Erträge in der Gartenpflege erwirtschaftet werden können.


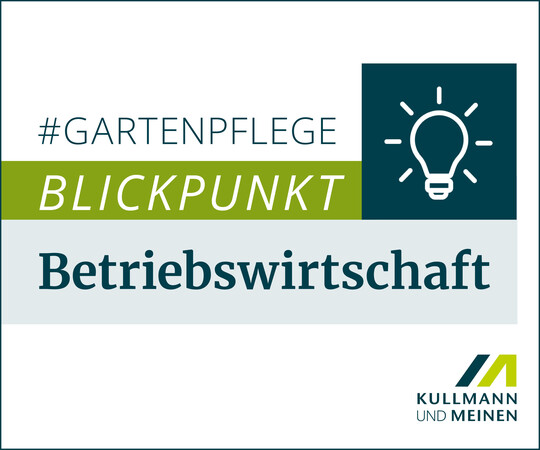


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.