
Klare politische Entscheidungen bringen Aufträge
Egal, in welchen Landesverbänden man nach der Stimmung bei den Mitgliedsbetrieben fragt, überall lautet die Antwort ähnlich: Die tatsächliche wirtschaftliche Lage ist positiver als zu Beginn des Jahres befürchtet. Das ist auch im Norden aus den Landesverbänden in Schleswig-Holstein (SH), Hamburg (H), Mecklenburg-Vorpommern (MV) und Niedersachsen-Bremen (NDS-B) zu hören.
von Susanne Wannags erschienen am 15.08.2024Patrick Büch, stellvertretender Geschäftsführer beim Verband GaLaBau (VGL) NDS-B, ordnet den leichten Anflug einer eher gefühlten als tatsächlichen Krise erst einmal ein: „Wenn unsere Branche sagt, dass es nicht mehr ganz so gut ist wie in den Vorjahren, darf man nicht vergessen, dass wir einige Jahre eine Auftragslage weit über dem üblichen Niveau hatten. Das hat sich nun normalisiert.“ Für manch junge Betriebsinhaber, die von dem Auftragshoch während und nach der Pandemie profitiert hätten, sei diese „Normalität“ möglicherweise ein Einbruch. „Alte Hasen“ wüssten, dass es ein Auf und Ab gäbe. Was auffällt: „Die Lage des eigenen Betriebs wird meist besser eingeschätzt als die Lage der Branche.“
Nach den Zukunftsaussichten gefragt, zeigen sich die Betriebsinhaberinnen und -inhaber immer etwas zurückhaltend. Für VGL-Geschäftsführer Reinhard Schrader ist das nichts Neues. „Wir befragen unsere Mitglieder seit 2005 regelmäßig, und in den fast 20 Jahren ist es nicht einmal vorgekommen, dass im Durchschnitt aller Betriebe die zukünftigen Perspektiven besser eingeschätzt wurden als die aktuelle Situation.“ Während es vor allem im Segment des gehobenen Privatgartens genug zu tun gibt, spürt man im Ausschreibungsmarkt an der ein oder anderen Stelle etwas mehr Konkurrenz durch den Tiefbau. Hier allerdings spielen Themen wie Klimawandel und die Forderung nach mehr Grün in den Städten den Landschaftsgärtnern in die Karten, denn hier ist grünes Know-how gefragt.
Förderungen sorgen für Investition in Grün
In Hamburg zeigt sich, wie positiv sich eine klare politische Entscheidung für mehr Grün auf die Branche auswirkt. 2014 begann man dort mit einer Gründachstrategie. Dabei geht es nicht nur um öffentliche Gebäude, sondern auch um die Begrünung privater Wohn- und Nichtwohngebäude. „Dafür wurden 3,5 Mio.?€ Fördermittel freigegeben“, sagt Dr. Michael Marrett-Foßen, Geschäftsführer des Hamburger Fachverbands. Vorausschauend wurden auch Investitionen in Photovoltaik plus Dachbegrünungen als förderfähig in das überarbeitete neue Programm mit aufgenommen. Auch wurden die Zuzahlungen pro m² begrünter Dachfläche nochmals großzügig aufgestockt, sodass bis zu 60?% der Kosten gefördert werden. Diese Gelder können noch bis Ende 2026 beantragt werden.
Ab 2027 werden Gründächer mit Solaranlagen für Neubauten und bei Dachsanierungen in Hamburg Pflicht sein – ein Umstand, der jetzt und in Zukunft einigen Betrieben gute Aufträge und Umsätze sichern wird. „Auch weil die Stadt weiterhin Aufträge bezüglich Grünflächensanierung ausschreibt, leben wir hier ein bisschen auf der Insel der Glückseligen“, gibt Dr. Marrett-Foßen zu. Dass dem so ist, dafür hat auch die Expertise des Verbands und der Mitglieder gesorgt, die in die Entscheidungen zur Dach- und Fassadenbegrünung und im Bereich der naturnahen Grüngestaltung von den Behörden einbezogen wurden. „Bei der Entwicklung der Gründach-Strategie und des Klimaschutzgesetzes hat man auf uns gehört“, freut sich der Geschäftsführer.
Nachdenken über eine noch engere Kooperation
In Norddeutschland arbeiten alle Landesverbände gut und kollegial zusammen, mit Schleswig-Holstein kooperiert Hamburg jedoch besonders eng. „Wir arbeiten auf vielen Gebieten, zum Beispiel im Bereich Social Media, Homepage und Seminare, bereits zusammen, und unsere Geschäftsstellen liegen gerade mal 30?km auseinander“, sagt Achim Meierewert, Geschäftsführer des Fachverbands S-H. Genug Gründe, um über eine mögliche Zusammenlegung der Geschäftsstellen nachzudenken. „Die Idee gab es vor 20 Jahren schon einmal“, erzählt er. Damals wurde allerdings im „stillen Kämmerlein“ darüber diskutiert, ohne die Mitglieder mit einzubeziehen. Ein Fehler, denn die Abstimmungen auf den Mitgliederversammlungen über eine Verschmelzung der Verbände ergaben mit großer Mehrheit ein „Nein“.
Daraus hat man gelernt. „In diesem Jahr haben wir auf unseren Mitgliederversammlungen das Thema vorgestellt und uns das ,Go‘ dafür geholt, im nächsten Frühjahr eine Strategie zu präsentieren.“ Wer von den Mitgliedern sich daran beteiligen will, ist übrigens herzlich eingeladen.
Regionalgruppen neu beleben
Was die Auslastung der Betriebe in Schleswig-Holstein angeht, sieht es ähnlich aus wie im benachbarten Niedersachsen: Im Privatgarten-Bereich ist sie noch gut, im öffentlichen Bereich ist ein wenig Zurückhaltung spürbar. Was die Stundensätze angeht, die realisiert werden können, hängt es auch in Schleswig-Holstein erheblich vom Betriebssitz ab. „Manche Betriebe können sich eine Pflegestunde mit 58?€ bezahlen lassen, auf dem Land ist mancher froh, wenn er 35?€ abrechnen kann“, weiß Meierewert.
Ein wenig Sorge macht ihm das Thema Betriebsnachfolge. „Einige Firmen haben zugemacht, weil die Betriebsinhaber lieber gut bezahlt im Angestelltenverhältnis oder bei der Kommune arbeiten, andere finden keine Nachfolger.“ Mitgliederwerbung heißt die Devise. Dazu möchte der FGL S-H unter anderem die NordBau in Neumünster nutzen. Außerdem möchte Meierewert die Regionalgruppen in Schleswig-Holstein, die während der Pandemie etwas eingeschlafen sind und sich davon noch nicht so recht erholt haben, wieder neu beleben. „Wir überlegen uns hier neue Konzepte, beispielsweise ein Unternehmerfrühstück. Abends hat meist keiner mehr Lust, sich noch irgendwo zu treffen.“
Nachfolger und Fachkräfte gesucht
Der Fachverband Mecklenburg-Vorpommern ist der Vierte im Bunde der nördlich gelegenen Bundesländer. Dort sind anfängliche Unsicherheiten der Mitgliedsbetriebe, was die wirtschaftliche Lage angeht, mittlerweile einer größeren Gelassenheit gewichen. „Es ist genug Arbeit für die Betriebe da. Schwierig ist die Lage stellenweise für Betriebe, die nicht breit aufgestellt, sondern lediglich von einzelnen Auftraggebern abhängig sind“, sagt Verbandsgeschäftsführerin Meike Stelter. Im öffentlichen Bereich lautet die Devise momentan: „Wo früher drei Angebote ausreichten, muss man jetzt sechs schreiben, bis man einen Auftrag hat.“
Was – wie in anderen Bundesländern auch – jedoch tatsächlich ein wenig Sorgen mache, sei der Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Um dem abzuhelfen, möchte man in MV neue Wege gehen. Ein Schritt war die erste grüne Berufsmesse, die Ende Juni gemeinsam mit der Forst- und der Landwirtschaft stattfand. Interessierte konnten sich dort über die verschiedenen Berufe in den Branchen informieren und sie auch praktisch erleben.
Fachmessen zur Nachwuchswerbung nutzen
Auch in Niedersachsen-Bremen sind Nachwuchs- und Fachkräftemangel ein Thema, das sich von Betrieb zu Betrieb allerdings unterschiedlich gestaltet. Insgesamt steigen die Ausbildungszahlen bei den Landschaftsgärtnern in NDS-B. Um noch mehr junge Leute für den Beruf zu interessieren, geht man auch hier neue Wege. „Wir nehmen erstmals an der Freilandmesse in Tarmstedt teil, auf der in vier Tagen etwa 100.000 Besucher erwartet werden“, sagt Reinhard Schrader. „Wenn das Ergebnis dort positiv ist, dann werden wir dieses Konzept weiterverfolgen.“
Neu ist außerdem eine digitale interaktive Infoveranstaltung, bei der Betriebe aus verschiedenen Branchen Schülern jeweils eine Schulstunde lang das Berufsbild näherbringen und die Schüler online Fragen stellen können. „Ein Pilotprojekt bei einem Betrieb gab es dazu schon – in diesem Jahr wird das Format auf weitere Betriebe und Regionen ausgeweitet, berichtet Schrader. Was bei vielen jungen Menschen punktet, sind die Themen Klimawandel und Umweltschutz.
Um dem nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch in den Betrieben gerecht zu werden, hat man in NDS-B eine Seminarreihe zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gestartet. „Auch wenn der Begriff Nachhaltigkeit mittlerweile etwas überstrapaziert ist und – bis auf einige große Betriebe – die meisten anderen noch etwas Zeit haben, bis auf die Firmen eine Berichterstattungspflicht zukommt, ist nun der richtige Zeitpunkt, um sich damit zu befassen, findet Geschäftsführer Schrader. „Jetzt sind die Betriebe an einem Punkt, wo sie alles noch selbst gestalten können. Nachhaltigkeit ist ein sehr komplexes Thema und wir wollen den Firmen helfen, die Schwellenangst zu überwinden und zu zeigen, wie sie sich dem Thema ganz praktisch Schritt für Schritt im Betrieb nähern können.“
1Zu wenig Landesgartenschauen im Norden
Auch wenn die Aufgaben und Probleme der Verbände in den vier nördlichen Bundesländern ähnlich sind – vom Einsatz für weniger Bürokratie bis zur Nachwuchswerbung –, es gibt ein entscheidendes Merkmal, das Niedersachsen-Bremen den anderen drei voraushat: die Veranstaltung von Landesgartenschauen. Zumindest alle drei bis vier Jahre soll es in Niedersachsen eine Gartenschau geben. Das würde man sich in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auch wünschen.
In Hamburg fand 2013 eine Internationale Gartenschau statt, die vor allem durch ihr Millionendefizit in die Schlagzeilen geriet. „Doch auch mit Defizit war es für die Stadtentwicklung mit dem Sprung über die Elbe ein Riesengeschenk“, sagt Dr. Marrett-Foßen. „Der ehemalige IGS-Park, der heute Inselpark heißt, ist ein gutes Beispiel für nachhaltige Gestaltung und zeigt, wie das Problemviertel ,Wilhelmsburg‘ aufgewertet und in die Metropolregion Hamburg integriert wird.“
Kommunen fehlt das Geld
In Schleswig-Holstein gab es bisher drei Landesgartenschauen (2008, 2011 und 2016), seither ist Stille. Für 2020 war eine gemeinsame Gartenschau in Flensburg mit zwei dänischen Nachbargemeinden angedacht, deren Planung allerdings der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Glücksburg und Rendsburg liebäugelten mit Gartenschauen, sagten allerdings vor allem aus finanziellen Gründen ab.
„Landesgartenschauen werden von den Kommunen durchaus als Instrument der Stadtentwicklung gesehen“, sagt Achim Meierewert. „Das Problem ist die Co-Finanzierung. Die Städte wissen nicht, wo das Geld dafür herkommen soll.“ Sie wünschen sich finanzielle Unterstützung von der schleswig-holsteinischen Landesregierung, dort allerdings möchte man erst dann Zusagen machen, wenn es auch Städte gibt, die sich um eine LGS bewerben. Damit beißt sich die Katze in den Schwanz – eine Lösung ist aktuell nicht in Sicht.
In Mecklenburg-Vorpommern fand 2002 in Wismar die erste und einzige Landesgartenschau des Bundeslands statt, 2003 die IGA in Rostock. Rostock war als Standort der BUGA 2025 vorgesehen, machte jedoch vor zwei Jahren einen Rückzieher. Der Imageschaden für das Bundesland war enorm. Neben der Ratlosigkeit der Kommunen, eine Landesgartenschau zu finanzieren, ist für Meike Stelter ein entscheidender Faktor die fehlende Begeisterung: „Für Gartenschauen muss man brennen, sonst verläuft sich das Thema im Sand.“
Seit Juni 2022 sind neun Verbände aus den fünf Bundesländern nun in der Fördergesellschaft Landesgartenschauen Norddeutschland mbh vereint. Neben den vier norddeutschen GaLaBau-Landesverbänden sind das die Akteure aus Baumschule, Gartenbau und Landschaftsarchitektur. Was sich gemeinsam am aktuellen Gartenschau-Dilemma ändern lässt, bleibt abzuwarten.
Campos regional erscheint seit diesem Jahr in Form eines E-Mail-Newsletters in fünf Ausgaben: West (NRW), Südost (Bayern), Ost (Berlin, Hessen und östliche Länder), Nord (Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern) und Südwest (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland). Für das Magazin koppeln wir jeweils einen Überblick zur wirtschaftlichen Situation aus. Im Newsletter gehen wir ferner ein auf regiospezifische Zulieferer sowie auf regionale Besonderheiten, die für den GaLaBau relevant sind. Da es auch bezüglich der Datenverfügbarkeit Unterschiede gibt, werden die einzelnen Ausgaben individuellen Charakter haben. Für Vorschläge und Ideen aus Ihrer Region sind wir dankbar. Bitte schreiben Sie an dega@ulmer.de. Die Anmeldung zum Newsletter erfolgt über dega-galabau.de (siehe QR-Code).
Die vierte Ausgabe von campos regional wird von ACO, GaLaWork, der Hermann Mayer KG und der Hochschule Osnabrück unterstützt.Red














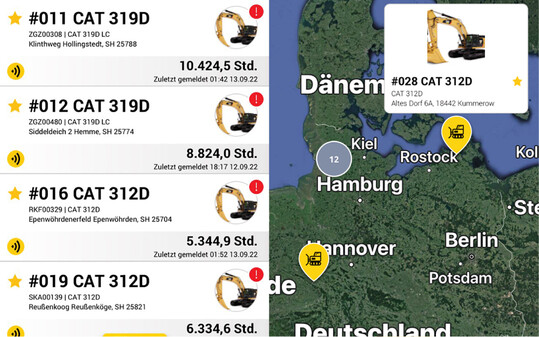








Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.