So wird Ihr GaLaBau-Betrieb nachhaltiger
Nachhaltigkeit ist ein vielstrapazierter (und auch häufig missbrauchter) Begriff. Doch der Gesetzgeber, die Kreditwirtschaft und immer mehr Kunden verlangen, dass Unternehmen tatsächlich nachhaltig wirtschaften. Und letztlich wollen auch immer mehr Mitarbeiter, dass enkelgerechter gearbeitet wird. Es ist deshalb ein Gebot der Stunde, die Prozesse umzustellen. Aber was heißt eigentlich nachhaltiges Wirtschaften im GaLaBau? Wir haben einmal die wichtigsten Punkte in einer Checkliste zusammengefasst.
- Veröffentlicht am

Betriebsführung
Am Anfang steht die Bewusstseinsbildung: Nachhaltigkeit ist nicht schwarz oder weiß, gut oder böse. Unser Wirtschaften hinterlässt immer einen Fussabdruck. Unser Ziel muss sein, einen Bewusstseinsbildungsprozess innerhalb des Unternehmens anzustossen und alle darauf zu verpflichten, darüber nachzudenken, ob und wie sich die Prozesse nachhaltiger gestalten lassen. Das Bewusstsein für die Einflussfaktoren ist der erste Schritt, nachhaltiger zu werden. Nachhaltigkeit bedeutet dabei, dass Prozesse so gestaltet werden, dass der mit ihnen verbundene Verbrauch von Ressourcen und das Emittieren von Kohlendioxid so heruntergedreht wird, dass auch zukünftigen Generationen noch dieselben Möglichkeiten offenstehen. Dabei geht es nicht nur um den Klimawandel, sondern auch um den Artenschutz/Biodiversität und den Schutz begrenzter Ressourcen.
Klare Ziele und Prioritäten formulieren: Je schwammiger das Wort "Nachhaltigkeit" verwendet wird, desto wichtiger ist es, den Begriff für das eigene Unternehmen zu schärfen. Was bedeutet Nachhaltigkeit für mein Unternehmen (Leitsätze formulieren, Definitionen aufstellen)? Was passt zu meinem Laden? Wie kann ich die Ziele vertreten? Wie kann ich meine Teams mitnehmen? Wie kann ich Defizite überbrücken und schlüssig kommunizieren? Unklar formulierte Ziele führen zu Beliebigkeit und ausbleibendem Umsetzungserfolg. Klare Prioritäten helfen, die wichtigsten Dinge nicht aus den Augen zu verlieren (Mehr dazu im Beitrag "Nachhaltigkeit").
Mitarbeiter mitnehmen: Klar, die Nachhaltigkeitsstrategie für das Unternehmen ist Chefsache. Doch nur, wenn die Mitarbeiter mitspielen und es ein gemeinsames Verständnis gibt, was alles ein Unternehmen nachhaltiger macht, kann die Strategie aufgehen. All die vielen kleinen Alltagsentscheidungen und Prozesse summieren sich. Und wenn das Bewusstsein für die entscheidenden Rädchen einmal geweckt ist, kann jeder mitmachen.
Geld nachhaltig anlegen: Geld bewegt in Sachen Nachhaltigkeit viel und je nachhaltiger das Geld investieren wird und arbeiten kann, desto größer ist das Ergebnis. Weshalb also nicht direkt mit einer Bank zusammenarbeiten, die ökologisch und sozial ausgerichtet ist? Steigert auch die Glaubwürdigkeit beim Kunden, wenn die Bankverbindung zu GLS, EthikBank, UmweltBank, Tomorrow & Co. führt.
Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und Umstieg auf alternative Antriebe/Stoffe: Der Kraftstoffverbrauch ist im Unternehmen der größte CO2-Verursacher. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte verbrauchen Energie. Ihr Verbrauch lässt sich reduzieren. "Entwickeln Sie einen Energiegeiz", ist die Idee von Prof. Thomas Brunsch von der Hochschule Weihenstephan. Das spart nicht nur Energie, sondern oft auch Geld, kann die Gesundheit der Mitarbeiter schonen (emissionsfreie Geräte) und verbessert dabei das Image.
Folgende Strategien sind denkbar:
> Anschaffung neuer Fahrzeuge und Maschinen mit besseren Verbrauchswerten oder alternativen Antrieben (Strom/Wasserstoff/Erdgas). Oft lassen sich die Investitionskosten durch öffentliche Förderung reduzieren.
> Schulung des Personals zur energiesparenden Gerätenutzung
> Kluge Arbeitsvorbereitung und Tourenplanung. Ein Einsatz von EDV-Systemen hilft, optimale Wege zu finden, unnütze Leerfahrten zu vermeiden und zusätzliche Besorgungsfahrten zu verhindern.
> Umstieg auf Mietsysteme bieten in der Regel den neusten Stand der Technik.
Jede Neuanschaffung ist zwar ein ökologischer Mehraufwand, fördert aber mittelfristig die Akzeptanz und Produktion sparsamerer Technik.
> Sonderkraftstoffe helfen Umwelt und Gesundheit zu schützen.
Reduktion des Gebäude-Energieverbrauchs/Produktion von Eigenenergie (Strom, Brennstoffe, Energiegewinnung): Zwar ist der Energieverbrauch von Büro und Hallen im Vergleich zum Energieverbrauch für Wege und Baustellenbetrieb vergleichsweise gering, dafür lassen sich hier deutliche Zeichen setzen – etwa durch eigene Stromproduktion (siehe Beispiel GardenArt aus Hamburg), zum Beispiel auf ungenutzten Gebäudedächern, oder im Außenbereich von Siedlungen durch ein Windrad. Da mittlerweile der Eigenverbrauch günstiger ist als das subventionierte Einspeisen, ist besonders Solarenergie für GaLaBau-Betriebe interessant: Denn wenn die Sonne scheint, laufen auch Rechner und Server. Die Optimierung der Heizungsanlage ist ebenfalls nicht nur ein Gebot in Sachen Nachhaltigkeit, sondern meist auch wirtschaftlich sinnvoll. Solarthermie und Hackschnitzelheizungen (bei der Versorgung mit auf der Baustelle gewonnenen Rohstoffen) können den Grad der Nachhaltigkeit steigern helfen.
Nachhaltig mobilfunken: Auch beim mobilen Datenverkehr lassen sich Zeichen setzen. Anbieter, wie WEtell haben sich dem Klimaschutz und der Fairness verschrieben. Einfach mal checken, was man wirklich braucht und dann den Anbieter wechseln.
Wasserverbrauch reduzieren (Betriebswasser, Gießwasser, Regenwassernutzung): Selbst wenn sich die Regenwassernutzung wegen des vielerorts immer noch unfassbar niedrigen Wasserpreises nicht direkt auszahlt - mittelfristig ist es der beste Weg, autark zu werden und Nachhaltigkeit zu vermarkten. Unter dem Motto "Unser Gießwasser kommt vom Himmel" kann die Regenwassernutzung - im Betrieb und beim Kunden - zum Teil einer Marketingstrategie werden (siehe dazu auch unser Merkblatt „richtig wässern“). Dass eine nachhaltige Wasserrnutzung im eigenen Betrieb Teil des Konzeptes ist, muss wahrscheinlich nicht extra erwähnt werden.
Umbau auf beleglose Prozesse: Für die meisten unter uns ist es noch ein Traum: das papierlose Büro. Doch seit der Gesetzgeber ermöglicht, die Unterlagen auch digital einzureichen, lässt sich die Verwaltung auch mit Dokumenten-Management-Systemen (DMS) handhaben. Viele Dinge werden auch weiter in (aus-)gedrucktem Zustand attraktiv bleiben (DEGA zum Beispiel, auch wenn es die natürlich auch digital gibt). Ordner mit Lieferscheinen oder Auftragsbestätigungen waren aber noch nie schick – wenn man nicht gerade Freak ist und auf Akten steht.
Ökobilanz der Büromaterialien: Für alle Materialien in der Verwaltung gelten die üblichen Nachhaltigkeitskriterien wie im übrigen Einkauf: Transportwege, Energieverbrauch für die Erzeugung, Recycelbarkeit – kurz, die Ökobilanz.
Ressourcenplanung beim Baustoffeinkauf: Wer viele Materialien verbaut und einkauft, unterliegt auch einem größeren Risiko, entweder zu wenig einzukaufen und deswegen nachträgliche Wege zu verursachen oder zu viel zu ordern. Die berühmten Baustellenreste, die auf zahllosen Betriebshöfen der Republik verwittern, sind nicht nur teuer, sondern auch alles andere als nachhaltig. Für den Betrieb sind sie extrem unökonomisch; es sei denn, es gibt ein sinnvolles Restemanagement; bestehend zum Beispiel aus ein, zwei Aufträgen im Jahr, in dem es sich wertschöpfend in Patchworkpflaster oder -mauern verbauen lässt – in einer Kita vielleicht oder in einem Privatgarten mit entsprechend motiviertem Kunden. Im Fall des Falles helfen Materialspenden an finanzschwache Einrichtungen oder ein Mietbrecher, der die Reste von Zeit zu Zeit in Mineralgemisch verwandelt – die Bilanz dafür wäre noch zu erstellen ;). Wer das vermeiden will oder kann, kann mit einer guten Ressourcenplanung die Reste in Grenzen halten.
Ökobilanzen von Baustoffen: Die Bewertung der Nachhaltigkeit von Baustoffen kommt mittlerweile einer Glaubensfrage gleich. Schließlich ist jeder Anbieter bestrebt, eine möglichst gute Bilanz vorweisen zu können. Komplexe Gegenüberstellungen zu analysieren und zu bewerten (soweit sie überhaupt vorliegen) ist im GaLaBau-Alltag kaum möglich. Da bleibt nur, sich auf Gütesiegel, Zertifikate und Herstellerangaben zu verlassen oder mit gesundem Menschenverstand einen Abwägungsprozess zu vollziehen. Eine Alternative ist, sich nach der Pareto-Regel (80 : 20) auf den kleinen Anteil der Baustoffe zu stürzen, die den größten Anteil am Verbrauch ausmachen, und dort tiefer in die Recherche einzusteigen. Oder man reduziert die Materialauswahl auf eine überschaubare Zahl recherchierter Produkte. Regional produzierte Produkte einzukaufen ist in der Regel eine gute Strategie. Die Transportwege sind kurz, der Umsatz kommt der Region zugute, die Produktion erfolgt nach heimischen Sozial- und Umweltstandards (siehe Beitrag: Die Vorteile heimischer Natursteine). Der Gartendesigner Peter Berg, der in der Regel mit regionalem Basalt oder Grauwacke arbeitet, oder die Gärtner von Richard & Winkler aus Wängi/CH, die auf Bodenseesandstein und Recyclingbaustoffe (siehe Beitrag) setzen, sind dafür gute Beispiele. Ökobilanzen kann man als Landschaftsgärtner im Übrigen auch beeinflussen:
Besonderes Augenmerk auf problematische Produkte richten: Tropenhölzer, exotische Natursteinmaterialien, Torf als Bodenverbesserer, PVC oder Teflon - es gibt eine ganze Reihe oft im GaLaBau eingesetzter Produkte, die aus unterschiedlichen Gründen zumindest in Verdacht stehen, nicht nachhaltig zu sein. Am einfachsten ist es, auf diese Produkte zu verzichten und Ersatzstrategien zu entwickeln. Wer meint, nicht auf diese Produkte verzichten zu können, sollte über vertrauensvolle Quellen (Siegel sind Garantie aber wenigstens eine Orientierungshilfe) einkaufen und stichhaltige Verwendungsbegründungen vorbereiten. Besonders bei Kunststoffen, die giftige Weichmacher freisetzen, als Mikroplastik im Nährstoffkreislauf landen oder Produkte unrecyclebar machen, ist besondere Vorsicht geboten!
Einsatz neuer Produkte kritisch prüfen: Bei der Einführung neuer Produkte wird das Pferd oft von hinten aufgezäumt - erst wird der Nutzen betrachtet, dann kommt das Marketing und erste lange danach folgt die Lösung potenzieller Entsorgungsprobleme. Achten Sie deshalb darauf, welche Inhaltsstoffe das Produkt enthält, das Ihnen angepriesen wird. Lassen Sie sich genau über sein Verhalten im Einsatz und unter Witterungseinfluss informieren. Fragen Sie energisch nach, wie lange der Lebenszyklus realistisch ist und wie das Produkt entsorgt wird. Verpflichten Sie das Unternehmen schriftlich auf spätere Rücknahme.Nachhaltig ist nur, Produkte zu verwenden, die sich rückstandslos wiederverwerten oder unproblematisch entsorgen lassen.
Verpackung von Baustoffen/Recycling: Mit dem Einkauf von Baustoffen lässt sich auch Einfluss auf die Verpackung nehmen. Geben Sie dem Lieferanten Rückmeldung, wenn unnötige Verpackung verwendet wird oder sie sich anders gestalten lässt. Bauen Sie ein Recyclingmanagement auf, in das alle Mitarbeiter einbezogen werden. So sollte für alle Stoffe festgelegt sein, wie sie gesammelt und auf welche Weise sie wieder dem Kreislauf zugeführt werden. Recycling kann auch zum festen Teil des Bauprozesses werden (siehe Beitrag).
Auch sozial zu handeln ist nachhaltig: Die soziale Nachhaltigkeit ist ein Thema für sich. In jedem Fall ist es nachhaltig im Hinblick auf eine lange Dauer von Beziehungen, sich sozial zu verhalten. Und zwar in Bezug auf alle Prozessbeteiligten – in unserem Fall sind das Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Subunternehmer und andere Baustellenbeteiligte. Wer in die Partner seiner Prozesse investiert, erhält stabile und langfristige Bindungen und hat weniger Verschleiß – sowohl in psychischer und physischer Hinsicht als auch in Bezug auf den Materialverbrauch. Denn Wechsel sind immer auch mit Papierkrieg, Verlust von Ausrüstung und unmotiviertem Umgang mit Ressourcen verbunden. Sozial nachhaltig zu handeln, stabilisiert außerdem die Gesellschaft in der unmittelbaren Umgebung und verbessert das Klima für Wirtschaftsabläufe, was beides der eigenen Unternehmung zugutekommt. „Trumpismus", also das Promoten von Pseudoerfolgen, Lautstärke, Egoismus und Effekte, funktioniert dagegen – wenn überhaupt – nur kurzfristig.
Gestaltung & Pflege
Nachhaltig gestalten: Ein Streifzug durch die Social Media fördert immer wieder stolz gepostete Vorher-nachher-Sequenzen zutage, die trefflich am Sachverstand des Urhebers zweifeln lassen. Anlagen, in denen sich Pflanzungen auf dem Nachherbild in Schotterwüsten verwandelt haben, mögen irgendeinem Kundenwunsch entsprungen sein; sie aber auch noch als vermeintlichen Ausweis der Kompetenz zu verbreiten, ist nicht sehr klug. Aber auch bei weniger plakativen Alltagsbeispielen: Gerade bei dem Ergebnis unserer Arbeit, dem Werk, ist der Einfluss auf die Nachhaltigkeit besonders groß. Welchen Wert hat die Ausgangsfläche für Natur und Kleinklima? Was wurde zerstört? Welcher Wert wurde neu geschaffen? Natürlich muss gerade im Privatgarten die Infrastruktur auf eine immer kleinere Fläche passen. Aber ein bisschen mehr Nachhaltigkeit ist da immer drin. Wer nachhaltig gestalten will, ist mit der Regel „so viele Pflanzen wie möglich und sinnvoll" schon mal gut bedient, wobei „blattabwerfend ist besser als immergrün", „fertile Blüte ist besser als sterile Blüte", „fruchttragend ist besser als nichtfruchttragend" und „heimisch ist besser als nicht-heimisch" mal sehr, sehr vereinfachte Unterpunkte darstellen, die als grobe Hilfslinie taugen. Auch andere Prinzipien naturnaher Gestaltung verbessern die Ökobilanz einer gestalteten Fläche. In diesem Beitrag finden Sie eine Übersicht. Ein Checkliste zur nachhaltigen Gestaltung von Gewerbegrundstücken finden Sie hier.
Weniger ist manchmal mehr: Bei jeder Maßnahme lässt sich überlegen, ist der Eingriff wirklich notwendig - und wenn ja, wie lassen sich die größten Spitzen im Verbrauch kappen. Muss der Oberboden wirklich abgefahren werden oder lässt er sich wertschöpfend vor Ort wiederverwenden? Kann vielleicht sogar auf Unterboden (Gerade in Verbindung mit heimischen Pflanzen) nachhaltig gestaltet werden und kann man auch dort auf Fahrwege und Kosten verzichten? Wie lassen sich grundsätzlich auf der Baustelle anfallende Materialien wiederverwenden? Gibt es vielleicht eine andere Technik, die zum selben Ergebnis führt? Für ein Unternehmen ist es immer ein Abwägungsprozess zwischen weniger machen und mehr verdienen. Aber bei so manchem Prozess lässt sich der Wertschöpfung auch in die Dienstleistung verlagern und damit von außen nach innen.
Recycling und Wiederverwendung sind sinnvoll: Auf der einen Seite fallen beim Neubau ebenso wie beim Umbau Materialien an, die sich auch wieder verwenden lassen. Auf der anderen Seite bleiben bei anderen Projekten auch immer wieder Reste übrig. Alles, was nicht neugekauft werden muss und einer neuen Verwendung zugeführt werden kann, verringert den Ressourcenverbrauch. Voraussetzung ist ein gutes Management anfallender Stoffe, das eine wirtschaftliche Verarbeitung gewährleistet, auf der anderen Seite ist manchmal erhöhter Kommunikationsaufwaqnd notwendig, um eine von der Gewohnheit abweichende Ästhetik zu erklären. Viele Recyclingstoffe können aber auch baukonstruktiv im nicht-sichtbaren Bereich wiederverwendet werden.
Veringern der Versiegelung: Zu nachhaltigem Gestalten gehört auch, das Spiel mit dem Anteil und dem Versiegelungsgrad der befestigten Fläche. Wieviel Fläche muss überhaupt befestigt werden? Wie intensiv muss diese Befestigung ausfallen und wie hoch ist der Versiegelungsgrad pro Quadratmeter? Oft sind durch die Verwendung von Schüttgütern (z.B. Kieswege und -plätze), Rasenfugensteinen oder Abstandhaltern geringere Versiegelungsquoten möglich.
Lebensdauer der Bauwerke beachten: Natürlich kann es wirtschaftlich sinnvoll sein, eine Anlage alle zwei Jahre neu zu bauen – wenn man es bezahlt bekommt. Sehr nachhaltig ist es wahrscheinlich nicht. Und es kommt darauf an, mit welcher Art von Energie und Baustoffen das Ganze realisiert wird. Sollte der Auftraggeber aber nicht zwischenzeitlich gewechselt haben, ist es in der Regel auf jeden Fall auch nachhaltig für die Kundenbeziehung, Werke mit langer Lebensdauer zu bauen, an dem Unterhalt zu verdienen und die Lebenszykluskosten im Rahmen zu halten.
Pflegeintensität der Bauwerke und Materialien: Grundsätzlich ist es sinnvoll, Bauwerke zu konzipieren, die mit überschaubarem Aufwand zu pflegen sind. Der Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln, der notwendig ist, um einen empfindlichen Stein in einem bestimmten Aussehen zu erhalten, ist eher nicht nachhaltig. Pflanzungen, die mehr Wasser brauchen, sind weniger nachhaltig als solche, die ohne Wassergaben auskommen.
Vermeidung von Pestiziden und übermäßiger Düngung: In der Vergangenheit galten chemische Wirkstoffe oft als Wundermittel der menschlichen Entwicklung. Doch ihr gedankenloser und undifferenzierter Einsatz hat an vielen Stellen zu massiven Umweltschäden geführt. Verzicht oder maßvoller Umgang gehören deshalb zum Kernelement eines nachhaltig wirtschaftenden GaLaBau-Betriebs.Verzicht auf empfimdliche Pflanzenarten, Auswahl an den Standort angepasster Pflanzen und qualifizierte Beratung helfen, dieses Ziel zu erreichen. Mechanische und thermische Flächenpflegeverfahren helfen ebenfalls, der Umweltbelastung durch Chemikalien vorzubeugen.
Nachhaltig pflegen und mähen: Gerade bei der Pflege von Grünflächen, lässt sich sehr viel Nachhaltigkeit realisieren. Von der Wahl der Mähsysteme (siehe Beitrag), über die Mähzeitpunkte und die Länge der Intervalle bzw. die Häufigkeiten der Mahd wird festgelegt, wieviel Biotopwert eine Fläche im Zuge der Unterhaltung behält. Überall da, wo die räumlichen Gegebenheiten günstig für Lebensgemeinschaften sind (sonnige Böschungen, feuchte Gräben, lückige Rasen etc.), sollte besonders bewusst mit Pflegetechnik gearbeitet werden. Bei der Verwendung von Verschleißkundstoffen (Trimmerfäden et.) sollte auf die Abbaubarkeit der Stoffe geachtet werden (Mikroplastik)
Verantwortung bei der Beratung tragen: Als Dienstleister haben wir grundsätzlich eine große Verantwortung im Rahmen der Beratung. Zwar verschanzen sich viele gern hinter der Aussage „Der Kunde hat es so gewollt!", aber da es sich bei unserem Angebot um eine Fachdienstleistung handelt, die Kompetenz also in der Regel beim Auftragnehmer liegt, ist es unsere Aufgabe, zumindest auf die Vorzüge und Nachteile bestimmter Produkte oder Leistungen hinzuweisen. Am Ende haben Unternehmerin oder Unternehmer immer noch die freie Wahl, ob sie einen Auftrag zu den geforderten Bedingungen annehmen oder nicht. Vor dieser Entscheidung steht aber die kompetente Aufklärung des Kunden. Da es sich in der Regel um Werkverträge handelt, ist ohnehin nur das Ergebnis festgelegt und nicht der Weg dorthin. Auch der Prozess lässt sich also noch nach eigenem Wissen und Gewissen nachhaltig beeinflussen.
Bleiben Sie beharrlich! Ohne Impulse ändert sich nichts. Auch bei größeren Herstellern/Lieferanten können Rückmeldungen zu Veränderungen führen, besonders wenn sie konsequent und wiederholt gegeben werden. Sie sind die Schnittstelle zwischen Industrie/Produktion und Konsument/in, Ihr Input ist entscheidend!Auch nachhaltig ist es übrigens, auf die eigenen Bemühungen aufmerksam zu machen. „Tue Gutes und rede darüber", lautet ein weiteres Sprichwort. Denn Werbung für nachhaltige Abläufe und Produkte steigert die Konkurrenzkraft desjenigen, der sie anbietet, und entfacht damit einen Wettbewerb in Richtung Nachhaltigkeit. Besonders nachhaltig ist das natürlich, wenn die Werbung keine Flut aus Werbeprodukten verursacht.
Gelebte Nachhaltigkeit im GaLaBau ist zusammenfassend betrachtet, keine Worthülse, sondern eine Erfolgsphilosophie, die im Großen und Kleinen darauf setzt, dass das, was heute funktioniert, morgen auch noch funktionieren kann.
Dossier: "Nachhaltigtkeit im GaLaBau"
> Im Leitfaden für nachhaltiges Wirtschaften im Garten- und Landschaftsbau (nur für Verbandsmitglieder) haben die Verbände Handlungsfelder für GaLaBau-Betriebe beschrieben.
> Im Buch Nachhaltigkeitsmanagement im Landschaftsbau (Ulmer, 2017, Alfred Niesel, 978-3-8252-4766-9) finden Sie Checklisten und Anweisungen für die Einführung eines Nachhaltigkeitsmanagements im Betrieb
Immer auf der Höhe bleiben: www.dega-galabau/abo


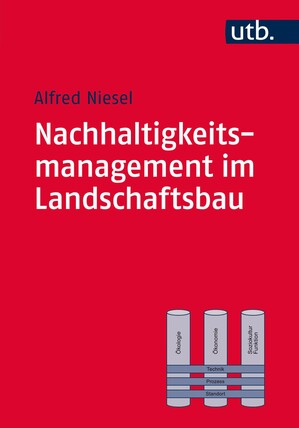




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.