
Marketingstrategie oder Greenwashing?
Im Südwesten kann man für nachhaltige Gestaltung Ökopunkte sammeln, die sich im Anschluss vermarkten lassen – wenn die jeweilige Kommune mitspielt. Wir haben uns am Beispiel eines Hausgartens in Esslingen mal angeschaut, wie das System funktioniert.
von Petra Reidel, Unlingen erschienen am 09.10.2024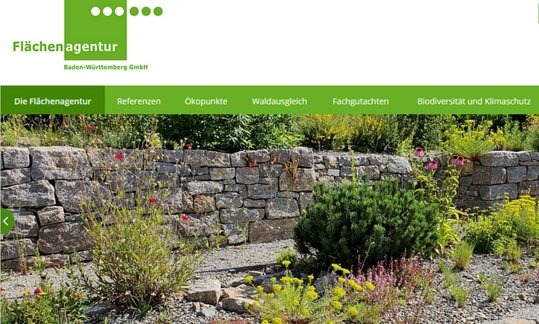
Sind Ökopunkte die neue harte Währung unserer Zukunft, wenn es um Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Genehmigung von Bauvorhaben geht? Sind Ökopunkte womöglich eine neue Marketingstrategie für GaLaBau-Betriebe oder doch eher eine Greenwashing-Nummer? Diese Fragen könnten zur Gewissensfrage werden. Sammeln lassen sich Ökopunkte durch Renaturierungsmaßnahmen und deren Bewertung mittels Biotopwertverfahren. Wie beim Sparbuch werden die Einlagen verzinst, und zwar mit 3 % im Jahr, ohne Zinseszins. Ökopunkte können selbst genutzt oder aber an Personen sowie Unternehmen weiterverkauft werden.
Feuchtbiotop mit terrassierenden Trockenmauern
„Wir waren 2017 auf einem Grundstück in Esslingen mit der Entfernung von Wildwuchs und alten, in Teilen abgestorbenen Gehölzen beschäftigt, um das Gelände für unsere neue Gartenplanung vorzubereiten, als der Anruf eines Nachbarn beim Baurechtsamt einen Baustopp nach sich zog“, beginnt Gunter Jacob, Geschäftsführer von Jacob Freiraumgestaltung in Wernau, seine Schilderung. „Auf unsere Nachfrage, was denn jetzt zu tun sei, forderte das Baurechtsamt ein Umweltgutachten, welches die Bauherrschaft beim Büro eines Tier- und Landschaftsökologen in Köngen beauftragte“, erinnert er sich.
Die dort von ihm eingereichte Gartenplanung wurde mit einem dicken Gutachten – einer sogenannten Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung unter Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes – sowie einer fünfstelligen Rechnungssumme beantwortet. „In dieser Abhandlung stand etwas von Ökopunkten. Das war mein Erstkontakt“, lacht Jacob, der sich danach ausführlicher mit dem Thema beschäftigte.
Jacob reichte mit Unterstützung eines Ingenieurbüros für Landschaftsökologie sein Leistungsverzeichnis und die Pläne zur geplanten Baumaßnahme zusammen mit dem erstellten Gutachten bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde ein, die sich dann an die Berechnung der Ökopunkte setzte. „Hierbei wurden im Leistungsverzeichnis die entsprechenden Faktoren für die Ökopunkte in den relevanten Positionen handschriftlich eingetragen. Für das Holzdeck oder den Rollrasen im unteren Gartenteil gab es, wie für einige andere ausgeführte Leistungen auch, keine Punkte“, erläutert Jacob.
Umsetzung mit hohem Punktestand
„Die Bäume im Eingriffsbereich boten keine Quartierpotenziale für Fledermausarten, es wurden keine Höhlen in den Stämmen registriert. Somit war die Nutzung als Winterquartier oder Wochenstube unwahrscheinlich. Die geplanten Erneuerungsarbeiten am Schuppen durften dennoch nur zwischen Oktober und Februar ausgeführt werden, falls der Schuppen von Fledermäusen zur Balz genutzt werden würde. Außerhalb dieses Zeitraums durften wir Arbeiten nur nach vorheriger kontrollierter Absenz von Fledermäusen durchführen. Ein Reptilienvorkommen geschützter Arten, beispielsweise der Zauneidechse oder Blindschleiche, war aufgrund der Habitatstruktur unwahrscheinlich. Um die vorkommenden Vogelarten zu schützen, war das Fällen der alten Gehölze ebenfalls auf die Monate von Oktober bis Februar eingeschränkt“, skizziert Jacob kurz ein paar Inhalte des Gutachtens.
Der geplante Garten stellte dagegen eine ökologische Aufwertung der Habitatsituation dar, vor allem aufgrund der Trockenmauern und des Teichs, wodurch von einer Erhöhung des Insektenvorkommens und einer Verbesserung des Nahrungsangebots für die Fauna im Gutachten ausgegangen wurde.
1Der für die ökologische Aufwertung des Geländes notwendige Aushub wurde mit einem Ökopunkt pro Euro abgerechnet, hier entsprechen also die Punkte den tatsächlich entstandenen Kosten. Die aus gebrauchtem Schilfsandstein gebauten Trockenmauern und auch das Feuchtbiotop wurden dagegen mit dem Faktor 1:4 (Euro:Ökopunkten) berechnet, da ihr Wert gegenüber der ursprünglichen Fettwiese innerhalb der Biotoptypen um ein Vierfaches höher liegt.
„Insgesamt haben wir für die gesamten Maßnahmen 1.080.000 Ökopunkte erhalten. Diese liegen nun auf dem Ökopunkte-Sparbuch des Kunden und werden jährlich mit 3 % verzinst“, verrät Jacob. Der Kunde besitzt nun weitaus mehr Punkte als er in Euro für seine Gartenanlage ausgegeben hat. (Zum Wert von Ökopunkten lesen Sie unten mehr.) „Diese Dimensionen sind vielen GaLaBau-Betrieben, aber auch den meisten Kunden vermutlich völlig unbekannt“, meint Jacob.
„Diese Dimensionen sind vielen GaLaBau-Betrieben, aber auch den meisten Kunden vermutlich völlig unbekannt.“ Gunter Jacob
Das so bewertete Gelände muss 30 Jahre in diesem Zustand erhalten bleiben, was einen gewissen Pflegeaufwand für die Trockenmauern und die Pflanzung bedeutet. Die Untere Naturschutzbehörde kann jederzeit zu Kontrollen vor Ort kommen. „Leider wurden wir nicht mit der Pflege beauftragt und das Gelände leidet etwas, da der ausführenden Person das benötigte Pflegefachwissen fehlt“, bedauert Jacob.
Bei einem weiteren Projekt in Sulpach (Ebersbach an der Fils) zog die Gemeinde in Sachen Ökopunkten leider nicht mit und verweigerte die Zusammenarbeit. „Die Idee war, einen Bauernhof in ein Seniorenheim umzubauen und über die Gartengestaltung mit Biotopen wie Trockenmauern, Streuobstwiesen und einen Naturteich einen Teil der Kosten durch Ökopunkte zu refinanzieren“, berichtet Jacob.
Moderner Kuhhandel
„Ich persönlich halte Ökopunkte nach diesen ganzen Erfahrungen mittlerweile für Augenwischerei und werde sicherlich kein Geschäftsmodell daraus entwickeln“, erklärt Jacob. Zudem befürchtet der Unternehmer, dass private Projekte in Zukunft gar nicht mehr bewertet und unterstützt werden könnten, sondern nur noch Maßnahmen von Städten und Gemeinden in diese Bewertung einfließen. Sind Ökopunkte somit eine moderne Form des Kuhhandels, den es bereits seit dem späten 19. Jahrhundert gibt und der in der Regel für fadenscheinige Tauschgeschäfte stand und steht? Gehandelt, geschachert, gedealt: Meist profitierte der Verkäufer und der Käufer wurde übers Ohr gehauen.
Bei den Ökopunkten steht die Natur an Stelle des Käufers, und zwar als Sache mit immer noch zu wenig Lobby in unserer gewinnorientierten Gesellschaft. Denn was ist nach 25 oder 30 Jahren, wenn die Biotoplaufzeit vorbei ist, die Pflege endet, die Flächenversiegelung aber immer noch besteht?
Faktencheck Ökopunkte
Ökokonto-Maßnahmen dienen als Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft, beispielsweise bei anstehenden Bauvorhaben. Die Kompensationshierarchie für Bauvorhaben wird durch den §15ff. im Bundesnaturschutzgesetz wie folgt festgelegt: „Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).“ Diese verlangte Aufwertung müssen die Verursacher jedoch nicht selbst leisten, sondern können auf bereits geleistete Maßnahmen aus dem gleichen Kompensationsraum zugreifen.
Durch die Bewertung mit Ökopunkten steht nun eine Werteinheit zur Verfügung, die ab der Umsetzung mit jährlich 3 % (ohne Zinseszins) auf dem Ökopunkte-Sparbuch verzinst und zu einer Wertanlage wird. Die Aufwertung von Natur wird zu einem handelbaren Produkt, das es bereits seit 25 Jahren in Deutschland gibt und vielerorts noch einen Dornröschenschlaf hält. Die Anlagedauer rentiert sich maximal zehn Jahre, danach fällt die Verzinsung weg und eine weitere Wertsteigerung auf diesem Sparbuch für Naturschutzmaßnahmen ist, bis zu einer konkreten Zuordnung, nicht mehr möglich.
Gehandelt werden Ökopunkte zu unterschiedlichsten Preisen. Die Spanne geht von 0,50 € bis zurzeit 7,00 €. Entscheidend sind Angebot und Nachfrage, aber auch die Bodenpreise sowie individuelle Vertragsbedingungen. Vor allem die Verordnungen der Bundesländer sind weitere Einflussfaktoren, denn die Gestaltung der Ökopunkte-Regelungen obliegt den Ländern.
Berechnung von Ökopunkten
Die Währung sogenannter Biotopwertverfahren, von welchen in Deutschland eine kaum zu überschauende Vielzahl – aufgrund der föderalistischen Strukturen im Naturschutzrecht – in Gebrauch ist, heißt Ökopunkte. 863 Biotoptypen (ohne technische Biotoptypen) gibt es laut dem Bundesamt für Naturschutz. Hierzu gehören sehr spezielle und vom Verschwinden bedrohte Typen wie Küstendünen mit Krähenbeeren, Muschelkalkbänke in der Nordsee, aber auch alpine Mähwiesen. Weniger spektakulär klingende Biotoptypen wie Trockenrasen, Magerrasen, Streuobstbestand und Feldgehölze sind hier ebenfalls aufgeführt.
Jedem Typ ist ein Biotopwert zugeordnet, der in der Regel von Bundesland zu Bundesland und sogar im Land selbst durch nicht zwingend landestypische Listen mit mehr oder weniger gängigen spezifischen Verfahren variiert. Eine Magerwiese mit Streuobstbestand wird in Baden-Württemberg mit 23 Punkten bewertet (der Streuobstbestand liefert hiervon nur vier Punkte), ein Acker mit Streuobstbestand (in diesem punktet das Streuobst mit sechs Punkten) erhält dagegen nur zehn Punkte. Beschattung und Eutrophierung durch Streuobst kann sich bei hochwertigen Biotopplanungen von Magerrasen sogar negativ auswirken und ist im Fall einer Neuplanung deshalb auch nicht vorgesehen.
Versiegelte Flächen (Gebäude, Straßen, Plätze, Pflaster mit engen Fugen, …) besitzen länderübergreifend einen Biotopwert von null, welcher durch Entsiegelungsmaßnahmen rasch aufzuwerten ist. Schotterwege werden in Baden-Württemberg beispielsweise mit zwei Ökopunkten bewertet, Graswege – inklusive Initialansaat mit gebietsheimischem Saatgut – mit sechs Ökopunkten und Erdwege, wie häufig am Waldrand anzutreffen, erhalten drei Ökopunkte.
Der Bau einer Trockenmauer mit fachgerechtem Hintergemäuer in Handarbeit und mit Herstellungskosten von 700 bis 1.000 €/m2 wird in Baden-Württemberg mit einem Biotopwert von vier Punkten/€ berechnet. Das bedeutet, bei einem Wertansatz von 800 €/m2 werden dem Ökokonto des Kunden 3.200 Ökopunkte für jeden gebauten Quadratmeter gutgeschrieben.
Hinzuziehen von Büros fast unumgänglich
Wer in die Bewertungsverfahren und -kriterien sowie in die Biotopplanung eintaucht, stellt schnell fest, dass dies eine Wissenschaft für sich ist und das Hinzuziehen landschaftsökologischer Planungsbüros oder spezialisierter Landschaftsarchitekturbüros bei der Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde fast unumgänglich ist. Ein Grundbucheintrag zur Sicherung der Maßnahme kann erforderlich sein. Häufig werden die Fläche sowie die Dauer des Eingriffs unter anderem durch Pflegeverträge mit der Unteren Naturschutzbehörde gesichert und dokumentiert.
Die Dauer der Kompensationsmaßnahme wird zwischen dem Flächeneigentümer und dem Eingriffsverursacher vertraglich festgelegt. Hier haben sich laut Recherche zwischen 25 und 30 Jahre durchgesetzt. Fallen dauerhafte Pflegemaßnahmen an, werden diese häufig auf den Verkäufer der Ökopunkte übertragen, so er weiterhin Eigentümer bleibt und die Fläche nicht mitveräußert, weshalb dies auch Auswirkungen auf den Preis seiner Ökopunkte hat. Der Status der Fläche ändert sich durch die Renaturierungsmaßnahme und kann nicht einfach wieder zurückgestaltet werden. Eine Haftung für Schäden infolge höherer Gewalt empfiehlt sich vertraglich zu regeln.
Punktehandel
Die berechneten Ökopunkte vergeben die Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise und Kreisfreien Städte. Die Ökokonten liegen ebenfalls bei den Unteren Naturschutzbehörden. Diese haben Einsicht, wem welche Ökopunkte gehören und an wen diese zu welchem Zeitpunkt weiterverkauft wurden, was einen relativ transparenten Handel ermöglicht. Der Vorlauf von Kompensationsmaßnahmen kommt vor allem der Natur entgegen, da es oft Jahre bis Jahrzehnte benötigt, bis der Ausgangszustand einer bebauten und somit zerstörten Fläche an anderer Stelle erreicht ist.
Wer Ökopunkte besitzt, kann diese frei anbieten und verkaufen. Es gibt einige Plattformen, beispielsweise die Webseiten www.kompensationsmarkt.de oder www.ökopunktemarkt.de, auf welchen Ökopunkte kostenlos inseriert werden können.
Im ersten Schritt wird die Summe der Ökopunkte der gesamten Fläche im Zustand vor dem Eingriff ermittelt. Die Auswirkungen des Eingriffs – beispielsweise einer Baumaßnahme – auf Natur und Landschaft werden auf dieser Grundlage prognostiziert und ebenfalls in Ökopunkte umgelegt. Die Differenz beider Summen ergibt dann die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen, ausgedrückt in Ökopunkten. Bezahlt werden kann mit bereits vorangegangenen Kompensationsmaßnahmen und somit auch mit dem Einkauf von Ökopunkten oder aber mit einer Aufwertung von Natur und Landschaft, die den fehlenden Ökopunkten entspricht. Die Übertragung von Ökopunkten aus verschiedenen Biotopwertverfahren ist nicht möglich.
Dies zeigen folgende Beispiele: Das Verfahren „Arbeitsweise Bauleitplanung“ in Nordrhein-Westfalen bewertet den Biotoptyp Streuobstwiese, wenn es einen alten Baumbestand besitzt, mit 9 Punkten/m2. Beim Verfahren Ludwig, welches im Rheinland verbreitet ist, erhalten Streuobstwiesen mit alten Hochstämmen 20 Punkte/m2. Der Wert eines Biotoptyps ist immer abhängig vom gewählten Verfahren. Eine deutschlandweite Standardisierung wäre anzustreben.
Quellenangaben












Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.