Was ist eigentlich nachhaltig?
Jeder, der schon einmal versucht hat, nachhaltig zu wirtschaften, wird feststellen: Alles ist relativ, denn jede Handlung hinterlässt Spuren, und viele Dinge lassen sich nur schwer bewerten. Trotzdem sind wir gefordert, bewusster zu beraten, zu arbeiten und zu verbrauchen. Als Intro für unser Jahresthema haben wir mal einen kleinen Leitfaden zusammengestellt.
- Veröffentlicht am

Machen wir uns nichts vor: Solange wir uns ein Wirtschaftssystem leisten, das auf Wachstum ausgelegt ist – und sei es auch nur auf eines, das auf Inflation beruht –, müssen wir das Grundrauschen in jeder Ökobilanz mitdenken. Sprich: Bei der Betrachtung einer Solaranlage oder eines Gartens steht außer Frage, dass weniger Rohstoffe verbraucht würden, würden wir beides gar nicht herstellen. Da wir weiter produzieren und verkaufen wollen oder müssen, ist die Herstellung „guter Produkte" – im Sinne der Nachhaltigkeit – eine Grundvoraussetzung für unsere Tätigkeit. Es kann deshalb nur darum gehen, wie wir produzieren, welchen Einfluss das Produkt im Zuge der Nutzung auf die Umwelt hat und wie es sich nach der Nutzung wiederverwenden lässt. Denn Deponieren oder gar Verbrennen von Stoffen sind beide in einer Situation sich verknappender Ressourcen keine tragbaren Optionen.
Und um es vorauszuschicken: Beim bewussten Umgang mit Ressourcen geht es keineswegs um irgendwelche „Ökospinnereien", auch wenn das bestimmte Kreise aus sehr unterschiedlichen und meist vordergründigen Motiven suggerieren wollen.Es ist vielmehr hochgradig ökonomisch, die zunehmende Knappheit bestimmter Ressourcen im Blick, die Prozesse so zu planen, dass weniger Stoffe verbraucht werden.Zudem, und das wird oft verkannt oder bewusst verschwiegen: Jede Innovation kostet Kraft und Mittel, steigert aber die Wettbewerbsfähigkeit dessen, der sie sich ausgedacht hat. Die Widerstände gegen viele Auflagen sind zwar vor dem Hintergrund des wachsenden Aufwands erst einmal verständlich. Führen die Auflagen aber zu sinnvollen Weiterentwicklungen, steigt das allgemeine Qualitätsniveau und fördert besonders diejenigen, die sich den neuen Forderungen gestellt haben. Das soll ja auch die in bestimmten Branchen wieder eingeführte Meisterpflicht – nichts weiter als eine Auflage – bewirken.
WEDER GUT NOCH BÖSE
Um in der Sache weiterzukommen – was nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern am Ende auch notwendig ist –, macht es Sinn, sich von den Kategorien „Gut" und „Böse" zu trennen. Wie gesagt: Jede Handlung hat Einfluss, alles wird sehr schnell relativ. Es liegt einerseits im Ermessen jedes Einzelnen, möglichst sozial und nachhaltig mit den Ressourcen umzugehen, und andererseits im Ermessen der Gesellschaft – also der Politik in deren Vertretung –, Entwicklungen durch Gesetze oder andere Auflagen im Sinne von Nachhaltigkeit zu beeinflussen.Dass sie dabei nicht immer ein glückliches Händchen bewiesen hat, belegt die Vergangenheit und ist unter anderem dem Einfluss von Interessenvertretern oder mangelnder Kompetenz der Entscheider geschuldet. Aber grundsätzlich ist es so: Je mehr Einzelne nicht sozial und nachhaltig wirtschaften, desto eher und tief greifender mischt sich der Staat ein. Statt in Gut und Böse einzuteilen, ist es sinnvoller, mit relativen Kategorien zu operieren: Welche Entscheidung zieht welche Folgen nach sich? Sind bestimmte Dinge notwendig oder lassen sie sich nicht durch andere ersetzen? Lassen sich manche Ziele durch weniger Mitteleinsatz vielleicht sogar besser erreichen?
Es ist immer ein Abwägungsprozess. Deswegen ist es sinnvoll, bestimmte Strukturen auszuknobeln und bestimmte Produkte zu finden, von denen man überzeugt ist, und diese dann immer wieder einzusetzen. Das spart Zeit. Jeder neue Ablauf und jedes neue Produkt ziehen Recherchen nach sich.
Grundsätzlich liebt die Menschheit einfache Bilder: Da ist ein SUV ein schönes Feindbild. Wenn er aber zur Zugmaschine für den Fuhrpark wird, kann die Rechnung schon wieder ganz anders aussehen. Am Ende muss auch da jede Unternehmerin und jeder Unternehmer entscheiden, was sie oder er für das Selbstbewusstsein, das Standing beim Kunden oder für die Bequemlichkeit für notwendig hält – oder wie viel „Umweltsau" wir uns leisten wollen.
Die Felder sind vielfältig
Aber in einer energieaufwendigen und im wahrsten Sinne des Wortes einflussreichen Branche wie dem GaLaBau ist der Verbrauch des Chefautomobils ohnehin der kleinste Einflussfaktor. Nachhaltigkeit hat bei uns ganz viele Facetten, und bevor wir etwas ändern können, benötigen wir einen Überblick, welche Bereiche im Hinblick auf Nachhaltigkeit betroffen sind. Da sind zum Beispiel:
- Kraftstoffverbrauch von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen
- Energie im Gebäude (Strom, Brennstoffe, Energiegewinnung)
- Materialverbrauch Büro (Papier, Büromaterial, Sanitärartikel)
- Ökobilanz der Prozesse (Baumfällungen, Pflegetechniken, Abbau, Entsorgung, Müllaufkommen)
- Ressourcenplanung (Vermeidung von Baustellenresten)
- Ökobilanz der eingesetzten Baustoffe und deren Verpackungen
- Ökologischer Wert der hergestellten Flächen/Bauwerke (Wert Ausgangsfläche/Wert geschaffene Fläche)
- Lebensdauer der Bauwerke und Pflanzungen sowie der verbauten Materialien
- Pflegeintensität der Bauwerke und Pflanzungen sowie der verbauten Materialien
- Qualität der Beratung
- Beziehung zwischen Firma und Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Region etc. (soziale Nachhaltigkeit)
Diese Kriterien wollen wir im Folgenden einmal eingehender betrachten.
Kraftstoffverbrauch
Der Verbrauch von Kraft- und Betriebsstoffen ist vielleicht der offensichtlichste Bereich, in dem sich nachhaltiger wirtschaften lässt. Wo viele Maschinen und Fahrzeuge laufen, wird auch viel Energie gebraucht. Hier lassen sich einerseits bei der Anschaffung mit der Wahl von Antriebsart und Verbrauch Weichen stellen, andererseits durch sinnvollen Einsatz, schonenden Umgang und Schulung der Benutzer. Für GaLaBau-Unternehmer ist der nachhaltige Umgang mit diesen Stoffen schon deshalb reizvoll, weil damit auch eine direkte Kosteneinsparung einhergeht. Im Übrigen: Kaufentscheidungen bedeuten immer auch Einflussnahmen: Wenn keine sparsamen Geräte gekauft werden, werden – wenn es keine Einflussnahme des Gesetzgebers gibt – auch keine produziert.
Energieverbrauch der Gebäude
Zwar ist der Energieverbrauch von Büro und Hallen im Vergleich zum Energieverbrauch für Wege und Baustellenbetrieb vergleichsweise gering, dafür lassen sich hier deutliche Zeichen setzen – etwa durch eigene Stromproduktion, zum Beispiel auf ungenutzten Gebäudedächern oder im Außenbereich von Siedlungen durch ein Windrad. Da mittlerweile der Eigenverbrauch günstiger ist als das subventionierte Einspeisen, ist besonders Solarenergie für GaLaBau-Betriebe interessant: Denn wenn die Sonne scheint, laufen auch Rechner und Server.Die Optimierung der Heizungsanlage ist ebenfalls nicht nur ein Gebot in Sachen Nachhaltigkeit, sondern meist auch wirtschaftlich sinnvoll. Solarthermie und Hackschnitzelheizungen können den Grad der Nachhaltigkeit steigern helfen.
BÜRO UND PROZESSE
Für die meisten unter uns ist es noch ein Traum: das papierlose Büro. Doch seit der Gesetzgeber ermöglicht, die Unterlagen auch digital einzureichen, lässt sich die Verwaltung auch mit Dokumenten-Management-Systemen (DMS) handhaben. Viele Dinge werden auch weiter in (aus-)gedrucktem Zustand attraktiv bleiben (DEGA zum Beispiel, auch wenn es die natürlich auch digital gibt). Ordner mit Lieferscheinen oder Auftragsbestätigungen waren aber noch nie schick – wenn man nicht gerade Freak ist und auf Akten steht.
Für alle anderen Materialien in der Verwaltung gelten die üblichen Nachhaltigkeitskriterien wie im übrigen Einkauf: Transportwege, Energieverbrauch für die Erzeugung, Recycelbarkeit – kurz, die Ökobilanz.
„Das haben wir immer so gemacht", ist eine im GaLaBau beliebte Redewendung, die nicht ausschließt, dass man es immer falsch gemacht hat. Aber Spaß beiseite – in den Prozessen stecken viel Geld und Potenzial für Nachhaltigkeit! Einerseits geht es darum, Verschwendung auszumerzen beziehungsweise Verbrauch zu reduzieren, und auf der anderen Seite, Dinge nicht mehr zu tun, weil sie nicht sinnvoll sind. Das sind Abläufe im gewohnten Betriebsablauf (zum Beispiel unnötige Fahrten) ebenso wie Baustellentätigkeiten; etwa in Bezug auf den Umgang mit Boden (weniger Abfuhr/Austausch, Schutz der Bodenstruktur), den Einsatz von Pflegemaschinen (Schonung von Boden, Fauna und Flora), das Müllaufkommen (weniger Verpackungen), die Art der Entsorgung (sortenreine Trennung der Reste) oder die Rücksichtnahme auf den Bestand. Hier gibt es keine fertigen Bilanzen, sondern nur Ansätze. Wer nachhaltiger werden will, muss seine Prozesse auf den Prüfstand stellen und selbst bilanzieren (lassen).
Generell ist gute Planung ein wichtiger Baustein. Denn „Was man im Kopf nicht hat, muss man in den Beinen haben", lautet ein altes Sprichwort. Für Fußgänger geht das noch als Fitnesstraining durch – und ist damit positiv. Im GaLaBau bedeutet es in der Regel Reibungsverlust und Ressourcenverbrauch. Enrico Rösch, der sich bei der Firma Fichter (s. S. 34) mit Produktivitätsverlusten im Unternehmen befasst, sagt deshalb: „Der Hauptaugenmerk liegt bei den Bauleitern auf der Arbeitsvorbereitung." Kein Wunder. Arbeitsvorbereitung ist Planung. Wer den Tag und den Auftrag gründlich durchdenkt, sich Werk und Prozesse aufzeichnet und Eventualitäten vorausahnt, verbraucht am Ende trotz des Planungsaufwands weniger Ressourcen als derjenige, dem ständig einfällt, was er morgens mitzunehmen vergessen hat, und dafür noch einmal Wegstrecke zurücklegen muss. Auch bei allen anderen Entscheidungen ist entsprechender Vorlauf für die Nachhaltigkeit gut. Für den Betriebsgewinn sowieso.
Ressourcenplanung
Wer viele Materialien verbaut und einkauft, unterliegt auch einem größeren Risiko, entweder zu wenig einzukaufen und deswegen nachträgliche Wege zu verursachen oder zu viel zu ordern. Die berühmten Baustellenreste, die auf zahllosen Betriebshöfen der Republik verwittern, sind nicht nur teuer, sondern auch alles andere als nachhaltig. Zwar gehen die Reste aus Sicht des Lieferanten als das oben erwähnte Grundrauschen durch – für den Betrieb sind sie jedoch extrem unökonomisch; es sei denn, es gibt ein sinnvolles Restemanagement; bestehend zum Beispiel aus ein, zwei Aufträgen im Jahr, in dem es sich wertschöpfend in Patchworkpflaster oder -mauern verbauen lässt – in einer Kita vielleicht oder in einem Privatgarten mit entsprechend motiviertem Kunden. Im Fall des Falles helfen Materialspenden an finanzschwache Einrichtungen oder ein Mietbrecher, der die Reste von Zeit zu Zeit in Mineralgemisch verwandelt – die Bilanz dafür wäre noch zu erstellen ;).
Wer das vermeiden will oder kann, kann mit einer guten Ressourcenplanung die Reste in Grenzen halten.
Ökobilanzen von Baustoffen
Die Bewertung der Nachhaltigkeit von Baustoffen kommt mittlerweile einer Glaubensfrage gleich. Schließlich ist jeder Anbieter bestrebt, eine möglichst gute Bilanz vorweisen zu können. Komplexe Gegenüberstellungen zu analysieren und zu bewerten (soweit sie überhaupt vorliegen) ist im GaLaBau-Alltag kaum möglich. Da bleibt nur, sich auf Gütesiegel, Zertifikate und Herstellerangaben zu verlassen oder mit gesundem Menschenverstand einen Abwägungsprozess zu vollziehen. Eine Alternative ist, sich nach der Pareto-Regel (80 : 20) auf den kleinen Anteil der Baustoffe zu stürzen, die den größten Anteil am Verbrauch ausmachen, und dort tiefer in die Recherche einzusteigen. Oder man reduziert die Materialauswahl auf eine überschaubare Zahl recherchierter Produkte. Regional produzierte Produkte einzukaufen ist in der Regel eine gute Strategie. Die Transportwege sind kurz, der Umsatz kommt der Region zugute, die Produktion erfolgt nach heimischen Sozial- und Umweltstandards. Der Gartendesigner Peter Berg, der in der Regel mit regionalem Basalt oder Grauwacke arbeitet, oder die Gärtner von Richard & Winkler aus Wängi/CH, die auf Bodenseesandstein und Recyclingbaustoffe setzen, sind dafür gute Beispiele.
Ökobilanzen kann man als Landschaftsgärtner im Übrigen auch beeinflussen: Wer bestimmte Herkünfte oder Verpackungsformen nicht nachhaltig findet, sollte das seinem Lieferanten deutlich mitteilen. So werden Veränderungen angestoßen.
Ökologischer Wert der hergestellten Produkte
Ein Streifzug durch die Social Media fördert immer wieder stolz gepostete Vorher-nachher-Sequenzen zutage, die trefflich am Sachverstand des Urhebers zweifeln lassen. Anlagen, in denen sich Pflanzungen auf dem Nachherbild in Schotterwüsten verwandelt haben, mögen irgendeinem Kundenwunsch entsprungen sein; sie aber auch noch als vermeintlichen Ausweis der Kompetenz zu verbreiten ist nicht sehr klug. Aber auch bei weniger plakativen Alltagsbeispielen: Gerade bei dem Ergebnis unserer Arbeit, dem Werk, ist der Einfluss auf die Nachhaltigkeit besonders groß. Welchen Wert hat die Ausgangsfläche für Natur und Kleinklima? Was wurde zerstört? Welcher Wert wurde neu geschaffen? Natürlich muss gerade im Privatgarten die Infrastruktur auf eine immer kleinere Fläche passen. Aber ein bisschen mehr Nachhaltigkeit ist da immer drin.
Wer nachhaltig gestalten will, ist mit der Regel „so viele Pflanzen wie möglich und sinnvoll" schon mal gut bedient, wobei „blattabwerfend ist besser als immergrün", „fertile Blüte ist besser als sterile Blüte", „fruchttragend ist besser als nichtfruchttragend" und „heimisch ist besser als nicht-heimisch" mal sehr, sehr vereinfachte Unterpunkte darstellen, die als grobe Hilfslinie taugen. Auch andere Prinzipien naturnaher Gestaltung verbessern die Ökobilanz einer gestalteten Fläche.
LEBENSDAUER DER BAUWERKE UND VERBAUTEN MATERIALIEN
Natürlich kann es wirtschaftlich sinnvoll sein, eine Anlage alle zwei Jahre neu zu bauen – wenn man es bezahlt bekommt. Sehr nachhaltig ist es wahrscheinlich nicht. Allerdings zeigt das Wort „wahrscheinlich" schon an – das ist wieder ein Abwägungsprozess. Sie wissen schon: das Grundrauschen. Und es kommt darauf an, mit welcher Art von Energie und Baustoffen das Ganze realisiert wird. Sollte der Auftraggeber aber nicht zwischenzeitlich gewechselt haben, ist es in der Regel auf jeden Fall auch nachhaltig für die Kundenbeziehung, Werke mit langer Lebensdauer zu bauen und die Lebenszykluskosten im Rahmen zu halten.
Pflegeintensität der Bauwerke und Materialien
Es soll Kundeninnen und Kunden geben, die einen mit den Worten „Am liebsten würde ich Sie jeden Tag hier sehen" begrüßen. Die Regel ist das eher nicht. Grundsätzlich ist es deshalb sinnvoll, Bauwerke so zu konzipieren, dass sie mit überschaubarem Aufwand zu pflegen sind. Stunden und Anfahrten wären dabei in der Betrachtung eher Grundrauschen, der Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln, der notwendig ist, um einen empfindlichen Stein in einem bestimmten Aussehen zu erhalten, ist eher nicht nachhaltig. Pflanzungen, die mehr Wasser brauchen, sind weniger nachhaltig also solche, die ohne Wassergaben auskommen. Auch bei diesem Teilbereich zeigen sich die Ambivalenz und die Schwierigkeit einer Nachhaltigkeitsbetrachtung. Da gibt es sicherlich Bereiche, in denen Nachhaltigkeit leichter zu definieren ist.
Große Verantwortung bei der Beratung
Als Dienstleister haben wir grundsätzlich eine große Verantwortung im Rahmen der Beratung. Zwar verschanzen sich viele gern hinter der Aussage „Der Kunde hat es so gewollt!", aber da es sich bei unserem Angebot um eine Fachdienstleistung handelt, die Kompetenz also in der Regel beim Auftragnehmer liegt, ist es unsere Aufgabe, zumindest auf die Vorzüge und Nachteile bestimmter Produkte oder Leistungen hinzuweisen. Am Ende haben Unternehmerin oder Unternehmer immer noch die freie Wahl, ob sie einen Auftrag zu den geforderten Bedingungen annehmen oder nicht. Vor dieser Entscheidung steht aber die kompetente Aufklärung des Kunden. Da es sich in der Regel um Werkverträge handelt, ist ohnehin nur das Ergebnis festgelegt und nicht der Weg dorthin. Auch der Prozess lässt sich also noch nach eigenem Wissen und Gewissen nachhaltig beeinflussen.
Auch sozial zu handeln ist nachhaltig
Die soziale Nachhaltigkeit ist ein Thema für sich. In jedem Fall ist es nachhaltig im Hinblick auf eine lange Dauer von Beziehungen, sich sozial zu verhalten. Und zwar in Bezug auf alle Prozessbeteiligten – in unserem Fall sind das Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Subunternehmer und andere Baustellenbeteiligte. Wer in die Partner seiner Prozesse investiert, erhält stabile und langfristige Bindungen und hat weniger Verschleiß – sowohl in psychischer und physischer Hinsicht als auch in Bezug auf den Materialverbrauch. Denn Wechsel sind immer auch mit Papierkrieg, Verlust von Ausrüstung und unmotiviertem Umgang mit Ressourcen verbunden. Sozial nachhaltig zu handeln stabilisiert außerdem die Gesellschaft in der unmittelbaren Umgebung und verbessert das Klima für Wirtschaftsabläufe, was beides der eigenen Unternehmung zugutekommt. „Trumpismus", also das Promoten von Pseudoerfolgen, Lautstärke, Egoismus und Effekte, funktioniert dagegen – wenn überhaupt – nur kurzfristig.
Auch nachhaltig ist es übrigens, auf die eigenen Bemühungen aufmerksam zu machen. „Tue Gutes und rede darüber", lautet ein weiteres Sprichwort. Denn Werbung für nachhaltige Abläufe und Produkte steigert die Konkurrenzkraft desjenigen, der sie anbietet, und entfacht damit einen Wettbewerb in Richtung Nachhaltigkeit. Besonders nachhaltig ist das natürlich, wenn die Werbung keine Flut aus Werbeprodukten verursacht. Allerdings gilt auch dort das eingangs Gesagte zum Thema Grundrauschen.
Gelebte Nachhaltigkeit im GaLaBau ist also, zusammenfassend betrachtet, keine Worthülse, sondern eine Erfolgsphilosophie, die im Großen und Kleinen darauf setzt, dass das, was heute funktioniert, morgen auch noch funktionieren kann.
Buchtipp
Nachhaltigkeit zum Nachlesen
Wer sich intensiver mit dem Thema „Nachhaltigkeit im GaLaBau" beschäftigen will, dem empfehlen wir das 2017 bei Ulmer erschienene Büchlein von Prof. Alfred Niesel „Nachhaltigkeitsmanagement im Landschaftsbau". Es kann direkt im Webshop bezogen werden.
Nachhaltigkeit im GaLaBau
Ältere Beiträge sowie alle Beiträge, die wir dieses Jahr zum Thema Nachhaltigkeit veröffentlichen, finden Sie im Nachgang auf unserer Webseite.

Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen










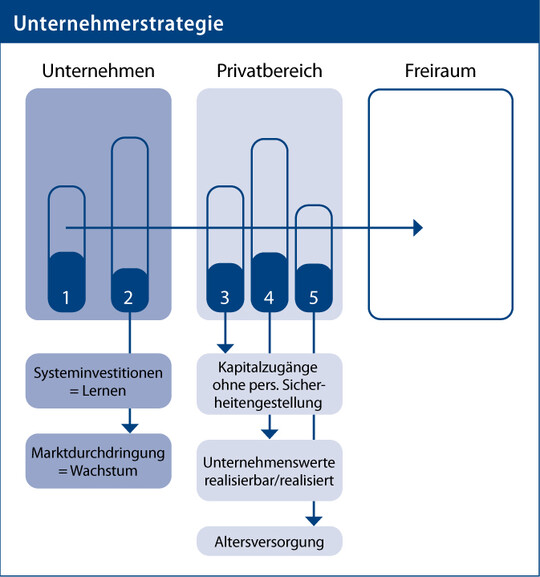










Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.