Ein Beitrag gegen den Fachkräftemangel
Sascha Kleinhaus ist GaLaBau-Unternehmer. Doch seine besondere Aufmerksamkeit gilt dem Konzept, europaweit Personal für die Branche zu gewinnen. Wir haben uns seinen Betrieb angeschaut und uns das Konzept und die geplante Zusammenarbeit mit der Firma Hermann Kutter in Memmingen erklären lassen.
- Veröffentlicht am
Papenburg ist die Meyer-Werft und die Meyer-Werft ist Papenburg. Der deutschlandweit bekannte Schiffsbauer hat die 36 000-Einwohner-Stadt verändert. Denn spätestens seit das Unternehmen angefangen hat, Kreuzfahrtschiffe zu bauen und dafür etliche Leistungen an Subunternehmer abgibt, kommen viele Menschen aus Osteuropa zum Arbeiten in die Stadt an der Ems – und viele bleiben.
In Papenburg kann man auch den Wandel der innereuropäischen Arbeitsmigration studieren. Während am Anfang osteuropäische Firmen billig bezahlte Landsleute mit Werkverträgen beschäftigt haben, hat die Arbeitnehmerfreizügigkeit dafür gesorgt, dass die Arbeiter aus den Ländern, für die sie eingeführt wurde, neue Freiheiten bekommen haben: Sie sind nicht mehr an die (oft schlechten) Werksvertragsverhältnisse gebunden, sondern dürfen sich selbst Arbeit suchen. Und das tun sie auch.
Dazu kommt: Die zweite große Einnahmequelle der Stadt ist der Unterglas-Erwerbsgartenbau. Die Gartenbauzentrale, eine Genossenschaft aus 44 Gartenbaubetrieben, liefert Topfkräuter und Gurken in die ganze Republik. Auch hier hat die Beschäftigung osteuropäischer Arbeitskräfte eine lange Tradition.
Diese Vorgeschichte muss man kennen, um zu verstehen, weshalb ausgerechnet ein GaLaBau-Betrieb aus dem Nordwesten auf die Idee kommt, Arbeitskräfte aus Polen, Ungarn und Rumänien in den Landschaftsbau zu vermitteln.
Am Anfang stand die Grünpflege
Sascha Kleinhaus ist schon früh mit der Meyer-Werft in Kontakt gekommen. Er hat nach der Schule bei einem GaLaBau-Betrieb ganz in der Nähe seines heutigen Firmensitzes eine Ausbildung gemacht. Das war ein „kleiner, aber feiner" Betrieb mit einem hohen Anteil an Pflegeleistungen, wie er erzählt. Ein Auftrag: Flächenpflege für die Meyer-Werft. Da stand Kleinhaus zum ersten Mal mit dem Freischneider auf dem Betriebsgelände am südlichsten Seehafen Deutschlands, als Pflegekraft.
Seitdem ist viel passiert. Zwei Dinge aber sind konstant geblieben: Die Pflege spielt auch in seinem 1999 gegründeten Unternehmen eine große Rolle, und für die Meyer-Werft arbeitet er heute noch immer – als Auftragnehmer.
„Einige Verbandskollegen sagen, ich sei nie ein richtiger Gärtner gewesen", sagt Kleinhaus darüber, was Kolleginnen und Kollegen über das Portfolio des Unternehmens denken. Das sei jedem unbenommen, das so zu sehen, meint er. Woraus der Unternehmer aber gar kein Hehl macht, ist, dass er sich im GaLaBau auf weniger anspruchsvolle Aufträge mit geringem bautechnischem Risiko spezialisiert hat; gerne auch als Subunternehmer für größere Unternehmen. Supermarktplätze und Erschließungsstraßen sind fester Bestandteil seines Angebots. Für die Landesgartenschau Papenburg 2014 hatte er zahlreiche Lose übernommen.
Kleinhaus hat eine Straßenbaulizenz. Das hänge auch mit der Qualifikation und den Interessen seiner Mitarbeiter, der Auftraggeberstruktur und der eher geringen Nachfrage nach hochwertigen Privatgärten in der Region zusammen, erklärt der Norddeutsche. Ab einer gewissen Betriebsgröße brauche man hier den Straßenbau und die damit verbundenen Volumenaufträge, um mit den Fixkosten klarzukommen. „Was wir können, sind Fleißarbeiten", sagt der Unternehmer und beschreibt das am Beispiel der Werft, die auch mal am Wochenende einen Dienstleister zum Saubermachen braucht, wenn sich montags eine Reederei angekündigt hat. „Es gibt Fleißarbeiten im GaLaBau, die super geeignet sind, um Menschen mit Migrationshintergrund in die Geschicke der Branche einzuführen. Schlussendlich haben wir alle mal mit einfachen Arbeiten auf der Baustelle angefangen!", findet Kleinhaus. Wenn ein Osteuropäer sich aus einem Werkvertragsverhältnis heraus bewerben möchte, um sich ein besser dotiertes Arbeitsverhältnis zu suchen oder sich beruflich zu qualifizieren – bei Kleinhaus war er in der Regel an der richtigen Adresse. Von da zur Idee der Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ ) war es dann nicht mehr weit.
ANÜ geht auch am Bau
Am Anfang stand die Erkenntnis, dass die Arbeitnehmerüberlassung auch im Bauhauptgewerbe – also in allen Branchen mit Wintergeldkasse – unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Voraussetzung ist: Es gilt für Ver- und Entleiher der gleiche Tarif, den Mitarbeitern wird vom ersten Tag an der gleiche Lohn gezahlt, und sowohl der Verleiher als auch der Entleiher sind winterumlagepflichtig gemäß der Baubetriebeverordnung. Kleinhaus erfüllt diese Bedingungen. Seine Kunden auch. Die nicht winterbauumlagenpflichtigen „Grünbetriebe" können, wie jedes Industrieunternehmen auch, in „klassischen" Zeitarbeitsfirmen Personal für Auftragsspitzen anmieten.
Die Erkenntnis, dass die ANÜ auch auf dem Bau geht, war zusammen mit dem Fachkräftemangel ausschlaggebend für das Geschäftsmodell. Denn ohne das Prinzip der ANÜ wäre es kaum möglich gewesen, das auf die Beine zu stellen, was der Unternehmer mittlerweile aufgebaut hat. Dabei wird die Personalüberlassung immer mehr zum Übergangsmodell. Aber dazu später mehr.
Vielleicht ist Kleinhaus in den Augen der Kollegen kein Gärtner mehr. Was er auf jeden Fall ist: ein guter Redner, ein umtriebiger Netzwerker und ein Unternehmer mit Leib und Seele. Das bezieht sich nicht nur auf sein ökonomisches Handeln, sondern erstreckt sich auf das ganze Schaffen. Kleinhaus war Schülersprecher, Vereinsvorstand, Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand, Parteivorstand, Stadtrat und engagiert sich heute in der Kinderschwimmausbildung. Seine Tätigkeit hat immer auch einen gesellschaftlichen, humanistischen Ansatz gehabt. Deshalb ärgert es ihn auch, wenn Kollegen ihn – selbst wenn es scherzhaft gemeint sein soll – „Menschenhändler" und „Sklaventreiber" nennen oder seine Leistung mit den Vermittlern von Werkverträgen gleichsetzen.
„Die Arbeitnehmerüberlassung wird immer wieder mit dem Werkvertrag in einen Topf geschmissen", sagt der 41-Jährige. „Aber nicht die Zeitarbeit führt zur Ausbeutung der Mitarbeiter, sondern die unfair verhandelten Werkverträge mit den einhergehenden Scheinselbstständigkeiten sind das Problem!" Dabei ist das, was Kleinhaus osteuropäischen Mitarbeitern anbietet, alles andere als Ausbeutung. „Wir zahlen weder Provisionen an Vermittler, noch nehmen wir den Bewerbern auch nur einen Euro ab", versichert Kleinhaus. Wir zahlen Tariflohn, Auslöse, Winterbau-Umlage und alles, was dazugehört. Letztlich sei es eine Chance, von der am Ende alle profitieren: der Mitarbeiter, der sich bewähren kann und die Gelegenheit für ein direktes Beschäftigungsverhältnis im Entleihbetrieb bekommt; und der Betrieb, der einen Impuls zur Lösung seiner Personalprobleme erhält.
„Wir arbeiten mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Wir müssen einschätzen, wo will der Bewerber (die meisten sind Männer) hin. Will er Karriere machen oder will er vielleicht nur ein paar Monate Geld verdienen", beschreibt der Norddeutsche seinen Ansatz. „Wir wollen einerseits genau herausfinden, wie die Bewerber ticken und andererseits müssen wir unsere Kunden genau kennenlernen. Dafür nutzen wir Telefoninterviews, Bewerbungsgespräche, recherchieren die Familiensituation des Bewerbers und die Ansprüche des GaLaBau-Unternehmens." Grundlage allen Tuns ist die Überzeugung, dass ein neu angebahntes Beschäftigungsverhältnis nur funktioniert, wenn alle Beteiligten wissen, worauf sie sich einlassen.
Betriebe müssen mitentwickeln
Die Nachfrage ist groß. Aber Kleinhaus war bisher gar nicht scharf darauf, in großem Maß neue Kundenbeziehungen einzugehen. Denn am besten klappt die Übernahme eben mit Betrieben, die schon Erfahrungen gesammelt haben. Es ist nämlich keineswegs so, dass ein GaLaBau-Unternehmer mal eben Mitarbeiter bestellt und dann passgenau Leiharbeiter mit Übernahmepotenzial bekommt. Es ist eher ein Prozess, der durchaus anstrengend und mit Rückschlägen verbunden sein kann. Wichtig ist, dass der Unternehmer seine Erwartungen anpasst und auch seinem Team klarmacht, was das Unternehmen sich von der Personalvermittlung erhofft und mit welchem Qualifikationsniveau die Bewerber zu Beginn auf die Baustelle kommen.
In der Regel kommen mehr oder weniger junge Männer mit handwerklichem Hintergrund, aber ohne Branchenerfahrung und oft nur rudimentären Sprachkenntnissen. Außerdem sind viele Bewerber in ihren Heimatländern eine andere Arbeitstaktung gewohnt. Die Zahl der bezahlten Stunden ist in Osteuropa deutlich höher, nur die Produktivität bleibt durch unzureichende Arbeitsvorbereitung und Ausrüstung dahinter deutlich zurück. „Die deutschen Baustellen sind aber mittlerweile so durchorganisiert, dass viele unserer Mitarbeiter sich an dieses Tempo erst gewöhnen müssen", erklärt Kleinhaus. Für die neuen Mitarbeiter ist deshalb erst einmal eine Akklimatisierungsphase angesagt, in der sie sich an das Arbeiten in Deutschland und die Gepflogenheiten der Branche anpassen müssen. Viele Osteuropäer hätten außerdem schlechte Erfahrungen gemacht, hat Kleinhaus beobachtet, wären schlecht bezahlt oder schlecht behandelt worden. Sowohl für den Vorarbeiter als auch für die Kolleginnen und Kollegen ist es wichtig, das zu berücksichtigen, Vertrauen aufzubauen und die Neuen nicht gleich am Anfang zu demotivieren.
So sieht das Modell aus
Zur Kleinhaus-Gruppe gehören zwei wirtschaftlich selbstständige Recruitingbüros in Warschau und Budapest. Dort, in Papenburg und ab Januar voraussichtlich auch in Memmingen, dem Firmensitz des GaLaBau-Unternehmens Kutter, laufen die Bewerbungen auf, die über die in der jeweiligen Landessprache gehaltenen Jobbörsen per Social Media hereinkommen. Kleinhaus sucht immer gleichzeitig für den grauen (mit einem Pflasterer-Motiv) und für den grünen (mit einem Gärtner-Motiv) Bereich, wobei sich in Osteuropa die Leute 20:1 auf die Stellenangebote im Baubereich bewerben. Gerade in Südosteuropa gibt es keine Tradition für die Landschaftsgärtnerei, das Image von Pflegetätigkeiten ist schlecht.
Nach einem Bewerbungsgespräch via Skype oder in einem der Büros wird der Arbeitsvertrag per Post ausgetauscht. Die eigenen Baustellen dienen dann häufig auch als Puffer und Testfeld. „Der GaLaBau muss mitwachsen, weil er auch eine Auslastung schafft, wenn die Nachfrage geringer ist, oder wenn mal jemand am Ende der Woche überbleibt", sagt Kleinhaus.
Wohnraum ist der Schlüssel zum Erfolg
Zentraler Anlaufpunkt ist ein Hotel in Gallmersgarten bei Rotenburg o. d. T., das Kleinhaus vor zwei Jahren gekauft hat. Hier kommen die Mitarbeiter aus Osteuropa an, werden montags bei der Gemeinde angemeldet, bekommen ihre Arbeitskleidung und werden eingewiesen. Von hier aus starten sie dann dienstags in die Betriebe.
„Die Wohnung und der Wohnsitz spielen in dem ganzen Konzept eine entscheidende Rolle", sagt der Unternehmer. Denn ohne Wohnung gibt es keine Anmeldung bei der Sozialversicherung, kein Konto und automatisch die Steuerklasse 6. Und die Wohnung entscheidet auch darüber, ob jemand sich wohlfühlt und den Kopf frei hat, um sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Häufiger Wohnungswechsel sorgt für Unruhe und Unsicherheit. „Umso korrekter wir die private Wohnsituation organisieren und mit dem Bewerber bei geplanter Einstellung auch kommunizieren, desto besser läuft die Integration in die späteren Betriebsabläufe", hat der Unternehmer festgestellt. „Wenn das Thema Wohnraum nicht ordentlich geregelt ist, können wir uns den Rest schenken." Ein weiterer Grund für das Scheitern von Projekten seien persönliche Ressentiments und Vorurteile etwa, weil der Vorarbeiter keine Rücksicht auf die fehlende Branchenkenntnis nimmt oder ein Problem mit der Herkunft des neuen Mitarbeiters hat.
Drei Mitarbeiter beschäftigt Kleinhaus alleine für das Thema „Wohnen". „Das hält uns hier ganz schön auf," gibt Kleinhaus zu. „Sie glauben auch gar nicht, wie oft wir da beschissen werden," erzählt er und berichtet von Wohnungen, die im Internet schön aussehen – wo die Leute dann aber irgendwo im Keller oder im Bauwagen im Garten schlafen sollen. Deswegen will der Unternehmer den Standort in Franken auch ausbauen. Die Pläne dazu liegen in der Schublade.
Das Problem mit dem Wohnraum hat dabei nicht nur der Personaldienstleister, sondern das haben auch seine Kunden. „Bei bestimmten Projekten kommen wir gar nicht in die Direktvermittlung rein, weil vor Ort der Wohnraum fehlt." Deswegen spiele die vorgeschaltete Überlassung in diesen Regionen auch so eine große Rolle. Kleinhaus empfiehlt jedem seiner Kunden, sich zeitnah um Wohnraum in der Nähe seines Standorts zu kümmern. „Nur so können wir gute Leute besorgen", gibt der Norddeutsche zu bedenken. „In den nächsten Jahren werden wir die Beschaffung von Wohnraum immer häufiger in die Hände der Kunden geben müssen. Denn sie kennen den Wohnungsmarkt in ihrer Region besser als wir in Papenburg."
Überlassung ist ein teurer Spaß
Billig ist es für ein Unternehmen nicht, seinen Bedarf bei Kleinhaus auf dem Wege der Arbeitnehmerüberlassung zu decken. Bis zu 36 Euro /h kostet der Mitarbeiter je nach Region und persönlichen Fähigkeiten. Bei Kleinhaus kommt davon wenig an. Erstens werden die Mitarbeiter selbst deutlich über dem Mindestlohn bezahlt, zweitens geht eine Menge Geld für Erstausstattung, Verwaltung, Logistik, Wohnen und Auslöse drauf. Deswegen sieht der Unternehmer die ANÜ auch nur als Einstieg in die Betriebsabläufe: „Wir möchten, dass möglichst viele Mitarbeiter von den Betrieben übernommen werden. Deswegen sehen wir die ANÜ als Einstiegsmodell, die einer späteren Festanstellung die Türen öffnet."
Das soll ab Januar 2019 so funktionieren:
- Die Kleinhaus GmbH im Norden und die die Firma Hermann Kutter GmbH & Co. KG im Süden schließen mit dem Entleihbetrieb einen ANÜ-Vertrag. Dieser Vertrag enthält neben allerlei rechtlichen Arbeitnehmerüberlassungsregeln einen Paragrafen, der eine Entschädigungszahlung im Falle einer Übernahme regelt.
- Übernimmt der Betrieb den Mitarbeiter bereits am ersten Tag, muss er zwei Brutto-Monatsgehälter zahlen. Übernimmt er ihn nach einem Monat, reduziert sich die Summe um ein 1/12. Nach 12 Monaten Entleihe entfällt die Entschädigungszahlung.
- In der gesamten Eingewöhnungszeit unterstützen die Muttersprachler bei den Dienstleistern mit ihrem Fullservice die Kunden, regeln die Angelegenheiten mit Ämtern und Vermietern, beantragen die Steuerklasse, kümmern sich um die GEZ, vermitteln zwischen Vorarbeiter und Mitarbeiter, wenn irgendetwas nicht läuft.
„Wir haben sechs ungarisch sprechende Mitarbeiter, drei für Polnisch und auch eine Kollegin für Rumänisch", erklärt der Unternehmer die Organisation. Das ermöglicht es, die Gespräche immer in der jeweiligen Muttersprache zu führen, was kritische Situationen schon mal deutlich entspannt. Die Begleitung durch regelmäßige Kommunikation hat bei Kleinhaus einen Namen. „Das läuft bei uns unter dem Begriff Assessmentcenter. Wir brechen das allerdings auf ein ganz einfaches Niveau runter", erklärt er. Dazu gehört, dass am Anfang ganz plastische Fragen gestellt werden, etwa, ob der Mitarbeiter gut aufgenommen worden ist und seine Schutzausrüstung erhalten hat. In dem ersten Gespräch sollen Mitarbeiter und Disponent erst einmal miteinander ins Gespräch kommen. Gleichzeit versucht die Disposition, möglichst viele Fakten zu bekommen, um zu bewerten, ob es rundläuft.
Nach 20 Tagen sieht der Ablauf ein weiteres Gespräch vor. Da gehe es dann schon ein bisschen ans Eingemachte, meint Kleinhaus. Die ersten Erfahrungen sind gesammelt und Anfangsschwierigkeiten beseitigt. Am 60. Arbeitstag gibt es ein Abschlussgespräch für die vertraglich vereinbarte Überlassungsphase. Im Idealfall kommt es dann zu einer Übernahme in den Betrieb.
Die drei Gespräche sind feste Punkte im Ablaufplan. „Uns geht es darum, dass es einen Gesprächsleitfaden gibt, dass da Struktur reinkommt und nicht nur über Probleme, sondern auch über die Zukunft gesprochen wird", beschreibt der Unternehmer das Vorgehen. Dazwischen stehen viele weitere Gespräche zwischen Disponent und Mitarbeiter; manchmal sogar täglich. Da kann es um ganz banale Dinge gehen, etwa wie ein Mitarbeiter an sein U-Bahn-Ticket kommt.¿„Wir wollen unser Angebot gerne auch durch die Direktvermittlung kostengünstiger machen und dadurch auch die Qualität verbessern", meint Kleinhaus. Mitarbeiter und Betrieb müssten allerdings zueinander passen.
Ab Januar auch im Süden
„Stefan Kutter und Dr. Markus Pfalzer kenne ich, seitdem ich mit der ANÜ begonnen habe", erzählt Kleinhaus. Die bayerische Firma war einer der ersten Kunden. „Wir arbeiten seit Jahren super zusammen und unsere Mitarbeiter arbeiten gerne auf den Kutter-Baustellen." Um der wachsenden Nachfrage und den immer größer werdenden Anforderungen an die Logistik besser gerecht zu werden, wollen Kutter und Kleinhaus beim Angebot von Personaldienstleistungen nun gemeinsame Sache machen. Der eine wird dann das Personal und die Kunden im Norden betreuen, der andere im Süden.
Mit der geplanten Gründung der Allianz haben sich die Unternehmer eine Menge vorgenommen. Neben der Direktvermittlung und dem Ausbau von Wohnraum wollen sie das Recruiting europaweit breiter aufstellen, als es bislang der Fall war. Kleinhaus hat bereits eine Software im Einsatz, mit der sich Bewerbungen in 60 Sprachen verwalten lassen. Dass die ersten Versuche der Verbände, zum Beispiel in Spanien Azubis zu gewinnen, fehlgeschlagen sind, schreckt die Unternehmer dabei keineswegs ab. Vielmehr sehen sie ihren Ansatz durch die Misserfolge der Vergangenheit bestätigt. „Bei den Spaniern sind die Schnittstellen nicht sauber genug definiert worden", ist Kleinhaus überzeugt. Grade die nicht gelösten Probleme mit der Unterkunft und unklare Perspektiven sind seiner Meinung nach Gründe für das Scheitern gewesen.
Ein Problem, das er auch bei den Südosteuropäern gerade wieder erlebe, sei deren Erwartung. „Viele glauben, dass das Geld hier vom Himmel fällt. Wir müssen immer wieder kommunizieren, dass wir in Deutschland über richtige Arbeit sprechen", sagt er. Überhaupt ist Geld oft ein Thema. Am Beispiel des Programms MobiPro kann er Fehleinschätzungen der ersten Versuche erklären: „Wir stellen uns das immer so phantastisch vor, dass wir jeden Europäer im dualen System ausbilden. Aber gerade in den ärmeren Ländern geht es um das Finanzielle. Die Familien in der Heimat brauchen Geld, und die Söhne haben keine Zeit, sich ausbilden zu lassen", erklärt Kleinhaus. Viele der MobiPro-Teilnehmer seien zwar aus dem Ausbildungsprogramm ausgestiegen, würden aber noch in Deutschland arbeiten. „Wir lassen die Leute einige Jahre arbeiten, um sich mit der Branche vertraut zu machen, und dann nehmen wir uns die Wintermonate und bieten erste einfache Schulungen verbunden mit Sprache an", ist Kleinhaus‘ Idee.
Gute Erfahrungen hat der Unternehmer mit Umschulungsmaßnahmen gemacht. Die werden von der Arbeitsagentur bezahlt und ermöglichen den Leuten trotzdem, einen Abschluss zu machen. „Zwei Ungarn und ein Pole haben das jetzt im Straßenbau durchgezogen – alle drei bestanden; der eine praktisch sogar als Prüfungsbester", freut sich Kleinhaus. Jetzt haben wir wieder sechs Leute im Straßenbau in der Umschulung", fügt er an. „Die Herren haben in den drei Jahren als Helfer begriffen, dass sie nur durch eine Ausbildung in Deutschland wirklich weiterkommen." Das habe ihm gezeigt, dass es nicht an der Motivation liegt, sondern eher daran, dass erst einmal die eigene Erkenntnis kommen muss, die Chancen der Zukunft zu nutzen. „Ich bin überzeugt, dass gerade bei den Helfern auf unseren Baustellen Talente schlummern, die wir fördern sollten", sagt Kleinhaus.
Eine Lösung für einen Teilbereich
„Ich glaube, es gibt eine Menge Lösungsansätze, und wir sind einer davon", fasst der Unternehmer sein Angebot zusammen. „Aber unsere Lösung braucht Zeit, Geduld und Toleranz. Sollten die Betriebe unser Konzept annehmen und sich mit uns auf die humanistische Ebene begeben, hat die Sache eine echte Perspektive." Mit Kutter wäre ein Partner gefunden, der ebenfalls einen hohen ethischen Anspruch an den Tag legt und sehr viel für die eigenen Mitarbeiter tut. Dafür ist das Unternehmen gerade mit dem Taspo-Award ausgezeichnet worden.
Jetzt muss im Januar erst einmal die Unterschrift unter den Vertrag und dann bleibt abzuwarten, was die Politik für 2019 noch an Überraschungen bereithält. Schließlich plant die Bundesregierung mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz ein Regelwerk, das den Bereich unmittelbar berühren könnte.
Hilfe bei der Sprache
Eigentlich war das interaktive GaLaBau-Bilder-Wörterbuch als Integrationshilfe für Flüchtlinge in den Berufsalltag gedacht. Aber auch bei der Beschäftigung von Arbeitskräften aus dem europäischen Ausland leistet die interaktive Lernhilfe gute Dienste. Da alle Begriffe im Kontext ihrer Verwendung gezeigt werden, können Ausbilder oder Vorarbeiter ihre Schützlinge entsprechend ihrer täglichen Tätigkeit lernen lassen. Wird der Lernerfolg dann an eine Verbesserung des Stundenlohns gekoppelt, sollte das Lernen noch mal so gut gehen.Das Buch gibt es für 29,90 Euro .
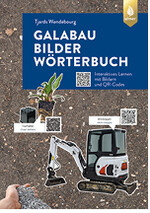
Den GaLaBau in Ungarn entwickeln
Kleinhaus’ Landschaftsbau-Betrieb in Deutschland läuft in ruhigen Bahnen. Mit Moritz Engelke hat der Unternehmer einen Meister gefunden, der den Betrieb führt. Welche Bedeutung der GaLaBau für den Unternehmer übrigens nach wie vor hat, mag eine andere Tatsache zeigen: Der Unternehmer will seine ungarische Firma von der Hauptstadt Richtung Plattensee verlagern und dort selbst Aufträge ausführen. Eine Erkenntnis seiner Analyse ist nämlich: Mit deutscher Produktivität lassen sich in Ungarn auskömmliche Preise erzielen, bei gleichzeitig weniger Konkurrenz und dem Angebot besserer Qualität – ein erster Schritt, die Branche in Ungarn auch durch eigene Marktpräsenz zu entwickeln. Außerdem will er Mitarbeitern, die gerne wieder nach Hause zurückkehren möchten, auch dort ein Jobangebot machen können.
In ganz Osteuropa sind das Leistungsspektrum und die Qualitätserwartung der Branche noch weit hinter dem in Deutschland üblichen Maß zurück. Mit jedem Heimkehrer wird ein Stück Landschaftsbauqualität made in Germany in die jeweiligen Länder getragen; ein kleiner Schritt, zu vergleichbaren Arbeits- und Lebensbedingungen in ganz Europa zu kommen.
Die GaLaBau Personal GmbH
Mitte Januar wollen die beiden GaLaBau-Firmen Kleinhaus in Papenburg und Kutter in Memmingen die GaLaBau Personal GmbH gründen. Mit den beiden Standorten in Niedersachsen und Bayern will das neue Unternehmen das von Sascha Kleinhaus entwickelte Konzept zum Rekrutieren und Verleihen/Vermitteln von Arbeitskräften in ganz Deutschland anbieten. Gemeinsam mit den beiden Kleinhaus-Tochterfirmen in Polen und Ungarn heuert die GaLaBau Personal GmbH in ganz Europa Arbeitskräfte an, die dann nach zwei Modellen in den GaLaBau vermittelt werden.
- Bei der Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) würde im Süden die Firma Hermann Kutter der Arbeitgeber und im Norden die Firma Kleinhaus. Die Stammbetriebe überlassen die Mitarbeiter dann an GaLaBau-Betriebe mit Personalbedarf; mit der Option, die Mitarbeiter nach drei Monaten zu übernehmen.
- Bei der Direktvermittlung stellt der GaLaBau-Betrieb ohne eine vorausgehende Überlassungsphase direkt ein. Die GaLaBau Personal GmbH übernimmt die Dienstleistungen ähnlich wie in der Überlassungsphase eines Mitarbeiters und berechnet die Leistungen über einen Zeitraum von sechs Monaten. Das Besondere: Auch bei der Vermittlung ist ein Fullservice-Paket inbegriffen, das von der Anmeldung am Wohnort, die Abwicklung von GEZ und Steuern bis zur Übernahme der Kommunikation in Landessprache sowie einem durchstrukturierten Assessmentcenter-Prozess reicht.
- Dr. Markus Pfalzer und Stephan Kutter wollen zusammen mit Sascha Kleinhaus eine Personalagentur gründen.
Burenweg 25, 26871 Papenburg
Telefon +49 49 61/66 419-0, Fax -20
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen


























Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.