Ein Paradies aus Grauwacke und Stauden
Frank Schroeder hat mit seiner Frau Nicole Frank im Bergischen Land ein Unternehmensmodell gefunden, das von ganz besonderer Gestaltung und einem großartigen Garten lebt. Das örtliche Gestein, die Bergische Grauwacke, spielt dabei eine herausragende Rolle. Wir haben uns im Ommertalhof angesehen, was „weniger ist mehr" wirklich bedeuten kann.
- Veröffentlicht am

>> Video: Frank Schroeder bearbeitet Bergische Grauwacke
Alles spricht von Nachhaltigkeit. Frank Schroeder und Nicole Frank leben sie. Der Gärtner und die Landwirtin haben vor 25 Jahren einen Ort gefunden, der nur 20 km von der nächsten Großstadt entfernt, ein Leben und Arbeiten in der Natur ermöglicht. Hier im Ommertalhof, einem Ortsteil von Lindlar, lassen sich Träume verwirklichen. Und der Traum, den die beiden realisiert haben, kann sich sehen lassen.
„Im Bergischen Land prasselt die Sonne auf’s Dach", sagt Frank lachend zur Begrüßung. Die opulenten Pflasterflächen im Eingangsbereich des ehemaligen Bauernhofes sind noch feucht vom letzten Regen. Die Vegetation ist wegen des kalten Frühjahrs drei Wochen zurück und trotzdem ist das wilde Pflanzenparadies rund um den Ommertalhof auch an diesem Maitag schon eindrucksvoll. Mit Bildern vom Hof war uns Schroeder im vergangenen Jahr in der Social Media aufgefallen, weshalb wir uns zu einem Besuch in Lindlar angemeldet hatten.
Nicole und Frank haben zu Quellwasser und Pizza in den Seminarraum geladen, den die beiden 2018 eingerichtet haben; als eines von zahlreichen Projekten, die immer parallel laufen. Und Frank erzählt, wie alles angefangen hat. Er hatte als Abiturient in der nahen Großstadt eine Ausbildung als Landschaftsgärtner begonnen – bei der Stadt und im Verbund mit einem GaLaBau-Betrieb; eine Zeit, die ausreichend Anekdoten für ein ganzes Buch geliefert habe. Der junge Mann wurde zwischen ausgebildeten Metallern sozialisiert, die nach der Pleite ihrer Firma im Grünflächenunterhalt untergekommen waren. Schroeder erzählt von dem Ärger, den er bekam, weil er sich weigerte, Orchideen in den öffentlichen Freiflächen wegzuhacken, von einer allgemein sehr eigenartigen Arbeitsmoral und davon, dass er seit den 80er-Jahren keine Armbanduhr mehr trägt, weil die Tätigkeit so langweilig war und die Zeit nie zu Ende ging. Auch vom „Lappöhrschen" erzählt er – der Schwarzarbeit mithilfe öffentlicher Ressourcen. Frank ist ein blendender Erzähler und man hofft, dass nur die Hälfte wirklich so passiert ist und sich heute niemals wiederholen würde. Romanstoff aus einer kommunalen Lebenswirklichkeit eben. Das Schöne an der Zeit bei der Stadt war: Frank hatte unendlich viel Zeit, sich mit Pflanzen zu beschäftigen und begründete dort sein heutiges Wissen. „Als ich nach fünf Jahren gesagt habe: Ich mach mich selbstständig, kam die Antwort: Da pokern Sie aber hoch", sagt er lachend. Er ging erstmal nach Essen auf die Meisterschule und machte sich im Oktober 1990 selbstständig.
„Alle anderen, mit denen ich zu tun hatte, haben mit Minibaggern angefangen", erzählt der Rheinländer. Er habe nur einen Kleinwagen mit Anhänger gebraucht. Denn sein Schwerpunkt waren von Anfang an Pflanzungen.
Frank ist ein typisches Kind der 80er-Jahre: Das Thema Umweltzerstörung wurde zu dieser Zeit zum ersten Mal gesellschaftlich thematisiert. Viele Menschen, die das bewegt hat, strebten in grüne Berufe. Frank engagierte sich zudem in seiner Heimatstadt Bergisch Gladbach im Naturschutz und kannte bald eine Menge Leute, die naturnahe Gärten gestaltet haben wollten. „Ich habe die ersten drei Jahre praktisch nur für BUND-Mitglieder gearbeitet", blickt er zurück. Mit der Bergischen Grauwacke kam er bereits in der Ausbildung in Kontakt: Die Stadt ließ hunderte Meter Kantensteine auf Friedhöfen entfernen und sie von eigenen Kolonnen zu Mauern aufschichten. Später, bei den Naturschutzprojekten, kam die Grauwacke dann immer wieder zum Einsatz – für Trockenmauern und Bachrenaturierungen. Frank lernte den Stein zu bearbeiten und bekam Kontakt zu einem der Steinbruchbesitzer. Zwischen ihm und dem Stein entstand eine enge Beziehung. Und die dauert bis heute an.
Das Zentrum der Arbeit gefunden
Nicole und Frank haben sich bei der Arbeit im BUND kennengelernt. Seit 1995 leben und arbeiten sie gemeinsam. Als sie 1996 eine neue Bleibe suchten, wollte sie etwas, wo man Tiere halten kann und er etwas, das näher an den Steinbrüchen in Lindlar liegt. Dass es dann der Ommertalhof wurde, war ein glücklicher Zufall und ziemlich mutig: Zwar war das Wohnhaus rustikal saniert – alle Nebengebäude waren aber heruntergekommen. „Wir haben das mit enorm dicken rosa Brillengläsern gekauft", staunt Nicole noch heute. „Wir waren ja gerade mal ein Jahr zusammen."
So rund 40.000 Arbeitsstunden haben die beiden in den 20 Jahren seit dem Kauf in Gebäude sowie Garten gesteckt. Bisher hat dieses Modell blendend funktioniert – obwohl der Hof, die Tiere, der Garten, das gemeinsame Arbeiten auch die Beziehung auf mehr als eine Probe gestellt haben: „Ich bin sehr harmoniebedürftig und er vergisst alles", erklärt Nicole lachend die Erfolgsformel. Gemeinsam haben sie ein großartiges Ensemble geschaffen, das mittlerweile jährlich 1.000 bis 2.000 Besucher anlockt; unter anderem über die „Offene Gartenpforte". Die Gäste entrichten ein Eintrittsgeld und kaufen Stauden, die die beiden selber kultivieren; oft als Nebentätigkeit der Pflege. „Die Besucher nehmen vor allen Dingen mit, dass ein Garten nicht geleckt sein muss", meint Nicole.
Der Garten ist Lebensmittelpunkt, Referenzobjekt, Akquiseinstrument, Fotostudio, Testlabor sowie Szenerie für drei Ferienwohnungen und die Seminare. „Das ist für mich Gartenkultur", sagt Frank. „Leute, die hier reinkommen und sich wohlfühlen, sind unsere Kunden", meint Nicole. 2018 war der Garten im Buch „Gärten des Jahres" – als exotisches Gegengewicht zu all den Anlagen mit Formgehölzen und Hortensia „Annabelle", wie Frank schmunzelnd bemerkt.
Vom Klein sein aus Prinzip
Am Anfang hat Frank mit Kumpels und Aushilfen gearbeitet. Dann kamen die ersten Auszubildenden und aus einem der Azubis wurde ein Meister. „Als wir viele waren, waren wir 5", meint der 56-Jährige. Das sei schon ganz schön stressig gewesen. Frank rieb sich an anstrengenden Kunden und suboptimaler Organisation auf. Zwei Hörstürze später trafen die beiden eine Entscheidung: zurück auf Anfang. Seit 2019 arbeiten sie nur noch zu zweit; spezialisiert auf Natursteinarbeiten und Pflanzungen – sie bauen gemeinsam, Nicole pflegt und organisiert. „Das sind weitgehend Altkunden, die irgendetwas Neues gemacht haben wollen", erklärt Frank. Meist seien es Projekte, mit denen man eine Woche beschäftigt ist und immer seien es sehr ausgefallene Sachen. „Seit fünf Jahren haben wir immer einen Auftragsvorlauf von einem Jahr", verrät der Unternehmer und gibt zu, dass er selbst immer noch zu oft „ja" sagt. „Sagen wir es mal so: Anfang März hat halb Deutschland damit gerechnet, dass Frank Schroeder den Garten macht", fügt Nicole grinsend an. Sie puffert seine Neigung zu viel anzunehmen dadurch ab, dass es nur eine 4-Tage-Woche und einen 14-Tage-Monat gibt. Dauert ein Projekt mal zwei Tage länger, hat der Monat 16 Tage.
Zudem haben die beiden eine Vision entwickelt, wie sich das Ganze zukunftsfest gestalten lässt. In den letzten Jahren entstanden die zwei Ferienwohnungen und sanitäre Anlagen für einen „Bauwagen" als Mobile Home. Gleichzeitig sollen Seminare und Planungen das Angebot erweitern. Der Garten bietet dabei ein optimales Umfeld. Hier können beide zeigen, wie sich Dinge entwickeln. Im letzten Jahr hat Frank viel in der Social Media geschrieben. Einerseits, um für Gartenkultur zu werben, andererseits um Bekanntschaften zu knüpfen; und auch ein bisschen, um schon mal die Zukunft vorzubereiten.
Große Wünsche habe man nicht. „Die Fahrt in den Steinbruch ist für uns wie Shoppen", sagt Nicole lachend. Ansonsten habe man alles, was man braucht.
Nahe am heimischen Stein
Die Betriebsgröße ermöglicht auch besonderes Arbeiten: Morgens zum Steinbruch, die richtigen Steine heraussuchen, die man dann für kleines Geld mitnehmen kann. Für Frank ist das wie eine Schatzsuche. „Ich fahr da hin, greif was raus und vergolde es", meint er grinsend. Denn der Vorteil ist nicht nur der günstige Preis, sondern auch die richtige Mischung, die ihm das Bauen besonderer Mauern erlaubt. „Mauern, die geschwungen sind, waren schon immer mein Faible", gesteht der Gärtnermeister. Mit einer solchen Mauer (Bild 3) war er 2020 dann ein zweites Mal im Buch „Gärten des Jahres".
Oft sind seine Bauwerke mit Pflanzen kombiniert, die direkt mit den Steinen zusammen versetzt werden (siehe Beitrag unter dega5630 ). Wir haben früher 6, 7 Stück/m² verwendet", erklärt er. Das sei zu viel gewesen. Jetzt sind es 3 Stück/m². Für jede Pflanze wird eine Aussparung von etwa 9 cm gelassen, die Pflanze eingelegt und mit einem Erdkern bis zum Anstehenden verbunden. In regelmäßigen Abständen sorgen Binder mit mindestens 25 cm Einbindetiefe für Stabilität. Die Kollegen würden sich immer lagerhafte Mauersteine kommen lassen. Da würden dann aber die Zwischengrößen fehlen. „Wir nehmen ja auch mal Steine mit 2 cm oder 4 cm Stärke", erklärt der Rheinländer. „Deswegen sehen unsere Mauern anders aus als fast alle anderen Mauern."
Das liegt nicht nur an der Schichtung, dem Schwung oder den Pflanzen: Frank verbaut auch Steine aus unterschiedlichen Brüchen. Drei größere und drei kleine Abbaustellen gibt es noch. Bis vor Kurzem gab es sogar einen alten Mann, der die Steine noch einzeln in seinem Bruch zugerichtet hat. Diese ehemals in der Gegend verbreitete Tradition hat viele Reste hinterlassen. Und auch die machen Franks Mauern besonders: Er arbeitet viel mit recycelten Materialien; unterstützt von der Firma Otto Schiffarth, die neben dem Neumaterial ebenfalls mit aufbereiteten Steinen handelt.
Dass Franks Art zu bauen gut ankommt, hat sich neulich gezeigt, als er via facebook-Gruppe (s. S. 68) einen Trockenmauer-Workshop über drei Wochenenden anbot: Da waren direkt zehn Leute dabei. „Alles junge Burschen, die jetzt in Richtung Meisterschule gehen", freut sich der Unternehmer.
Recycling als Geschäftsmodell
Das Recycling gehört natürlich nicht nur bei Naturstein zum Programm. Einen Beitrag über das Integrieren historischer Materialien in die Gestaltung ist ja bereits in DEGA erschienen ( dega5628 ). Darin zeigt Frank die Ausstrahlung von Materialkombinationen aus neuen und historischen Baustoffen; alten Klinkern, Natursteinbauteilen, Metallelementen und Holzbalken. Auch im Ommertalhof ist viel davon zu sehen. „Wir haben mal bei ebay 3 t belgische Klinker für 50 Euro geschossen. Das war unser bestes Schnäppchen", erzählt Frank schmunzelnd. Aus den Schieferschindeln eines Kirchendachs hat der Rheinländer eine sehenswerte Trockenmauer gebaut. Eine ganze Remise haben Nicole und Frank bei einem Kunden aus Abrissmaterial errichtet.
„Wenn man denkt, was die Leute früher KG-Rohre weggeschmissen haben", meint Frank im Hinblick auf die aktuellen Preisexplosionen. „Dadurch, dass alles so irre teuer wird, kommen die Leute vielleicht mal auf die Idee, bewusster mit den Baustoffen umzugehen", hofft er.
Ein Faible für Stauden
Das Besondere am Ommertalhof ist die Kombination aus Gestaltungselementen und Pflanzen; manches scheint wild und ist doch wohl geplant. Manches entwickelt Eigendynamik. Die Gestaltung zieht ihre Wirkung aus dem Zusammenspiel von Stein und Pflanze. „Blütenfarbe spielt bei mir überhaupt keine Rolle – aber Wuchsform und Endhöhe", erklärt Frank. Wichtig sei, dass es mit der Blüte ganz früh, bereits im Februar, anfängt und, dass es einen Herbstaspekt gibt. „Wir haben Ende Oktober mehr Farbe im Garten, als sonst das Jahr über. Und das machen wir bei unseren Kunden auch", verrät er. „Ich mache gerne Pflanzkonzepte, wo das Gros der Pflanzen nur 50 cm hoch ist und ein paar Highlights herausragen; das auch gerne mit vielen Heimischen – oder mit Wildstauden", ergänzt er und zählt eine Reihe von Pflanzen auf, die immer wieder verwendet werden; darunter der prächtige Bergknöterich ( Aconogonon speciosum ), Katzenminze ( Calamintha nepeta ), Plattährengras ( Chasmanthium latifolium ), Scheinsonnenhut ( Echinacea ‘Magnus’ und E. pallida ), Storchschnabelarten und -sorten, wie Geranium ‘Rozanne’, großblättrige Funkien ( Hosta ) wie die Sorte ‘Sum and Substance’, Helleborus foetidus und H. orientalis , die kurzlebige Witwenblume ( Knautia macedonica ), der Kerzenknöterich ( Persicaria amplexicaule ) und der Große Ehrenpreis ( Veronica teucrium ‘Knallblau’), von dem auch zahlreiche andere Sorten im Garten stehen. „Ich bin absoluter Cimicifuga-Fan", gesteht Nicole. Ebenso wichtig sei ihr der Waldgeißbart ( Aruncus dioicus ). „Was gibt es da für tolle Sorten, zum Beispiel ‘Horatio’." Für Frank gehört an jeden Teich ein Königsfarn ( Osmunda regalis ). Dazu gibt es viele rotlaubige Gehölze, von denen er sagt, dass sie bei vielen Kunden weniger gut ankommen. Und im Garten finden sich an allerlei Stellen gelblaubige Spiraeen als Strukturpflanzen. Gepflanzt wird übrigens so, dass die Topfballen praktisch auf der Pflanzfläche stehen und das Ganze dann mit einem Grünkompost von der Lenne-Deponie bis zur Oberkante des Topfballens angefüllt wird. Das unterdrückt vorhandene Unkräuter. Nach einem Jahr wird mit Rindenmulch nachgefüllt. Für die mageren Pflanzungen in der Sonne verwenden die beiden eine Mischung aus kohlensaurem Kalk und Splitt 2/5 als mineralischen Mulch. „Da kannst du toll drin arbeiten", findet Nicole.
Bei der Auswahl der Stauden spiele auch die Schneckenempfindlichkeit eine große Rolle, ergänzt sie. Allerdings gebe es nach den drei trockenen Jahren kaum noch Schnecken. „Wir hatten 1.200 mm Niederschlag, als wir hier eingezogen sind. Jetzt sind es wohl nur noch 850 mm", beschreibt der Gärtnermeister den Klimawandel im ehemals regenreichen Bergischen Land. Und damit verändern sich natürlich auch die Konkurrenzverhältnisse im Garten. Es gibt Gewinner und Verlierer. „Astilben pflanzen wir zum Beispiel gar nicht mehr", meint Nicole. „ Baptisia gehört dagegen zu den Klimagewinnern".
Genaues Beobachten der Dynamik gehört zur Philosophie der beiden. Die Ergebnisse fließen in die Beratungsarbeit ein. „Viele Gärten sind während der Mittagspause entstanden. Während wir da sitzen und unseren Kaffee trinken, entwickeln wir Konzepte", meint Nicole. Die Beziehung zu den Kunden sei oft freundschaftlich. Die Umstellung auf Kleinstbetrieb vor zwei Jahren mit der Einführung der 4-Tage-Woche habe zudem eine Menge Lebensgefühl gebracht. „Dieses Jahr bin ich das erste Mal im Juni rumgefahren und habe Projekte fotografiert", erzählt Frank. Es gäbe zwar viele Bilder aus dem Herbst – zur Hauptblütezeit sei aber nie die Zeit dafür gewesen. Auch für Austausch und Marketing ist nun mehr Zeit.
>> Termintipp: Ab April gibt Frank Schroeder wieder Natursteinseminare
Lindlarer Grauwacke
Gartenwürdiges Gestein mit großer Vergangenheit
Die Gesteinsbildung der Lindlar Grauwacke begann im Erdaltertum in der Periode des Devon (419 bis 358 Mio. Jahren). Zu dieser Zeit spielte sich Leben auf dem Land weitestgehend in den Küstenbereichen des Großkontinents Laurussia ab. Die Gezeitenzonen dieser riesigen Landmasse wurden von den Vorläufern von moos- , farn- und flechtenartigen Pflanzen besiedelt. Im Meer gab es bereits eine unüberschaubare Artenvielfalt an Muscheln, Schnecken, Brachiopoden, Dreilappkrebsen und Seelilien, deren Stengelglieder sich als Abdrücke besonders häufig in der Grauwacke finden lassen. 2009 wurde im Steinbruch Otto Schiffarth eine der ältesten bisher gefundenen Pflanzen entdeckt – mit einem Alter von 390 Mio. Jahren. Mehrere Exemplare dieses etwa 60 cm hohen Gewächses mit Namen Calamophyton (Bild rechts) wurden hier und später auch in angrenzenden Steinbrüchen gefunden.
Grauwacke ist ein Sedimentgestein mit hohem Quarzanteil. Die Lindlarer Grauwacke besticht außerdem durch die Härte des Gesteins und durch die Farbenvielfalt, hervorgerufen unter anderem durch Eiseneinschlüsse.
Heute wird das Gestein im GaLaBau sowie im Brücken- und Hausbau eingesetzt. Die weicheren Gesteinsschichten wurden früher oftmals auch für bildhauerische Zwecke genutzt oder, in Zeiten in denen Keramik zu teuer war, auch zu Sauerkrautbehältnissen und Schweinetrögen verarbeitet. Aufgrund seiner oft homogenen Grundstruktur eignet sich das Material hervorragend für Platten und Blockstufen. Große Rohblöcke werden mit Diamantsägen in Form geschnitten, die Oberfläche durch Sandeln oder Flammen veredelt. Es gibt Platten ab 3 cm Stärke oder Blockstufen von 15 cm Höhe, je nach Rohblock bis 150 cm Länge, und auch polymorphe Formen.
Polygonalplatten können entweder im Diamantschneideverfahren aus Rohblöcken oder durch Spalten der Schichten hergestellt werden. Besonders Platten mit mindestens fünf Außenseiten ergeben ein besonders harmonisches Fugenbild. Die farbintensivsten Platten sind die, die aus der Außen„haut" gewonnen werden. Das sind mit Eisenoxid eingefärbte, ungleich dicke Krustenplatten. Diese Platten entstehen an Schichtgrenzen und Rissen, in denen eisenhaltige Lösungen aufgestiegen sind. Die fugenenge Verarbeitung dieser Plattenart erfordert hohes Geschick, ein gutes Auge und scharfe Meissel oder Flexscheiben.
Mauersteine werden immer noch von Hand hergestellt. Große Blöcke werden dazu mit Pressluftbohrern und Spaltkeilen in kleinere Stücke geteilt und später mit Spalthämmern in handlichere, sogenannte lagerhafte Mauersteine geschlagen. „Lager" bedeutet, dass die Steine in die bei der Sedimentation entstandenen Schichten geteilt werden. Je paralleler diese Schichten sind, desto höher die Qualität der Mauersteine.
Die Feinkörnigkeit des Gesteins und die Härte lassen eine gute Bearbeitbarkeit zu. Die Mauersteine können bossiert werden (siehe Clip), hierbei wird die sichtbare Seite des Mauersteines rundum so beschlagen, dass alle Seiten auf einer Ebene liegen. Der mittlere Teil dieser Fläche heißt Bosse. Bei den Steinen für Trockenmauern kann man auf das Bossieren verzichten, hier können die lagerhaften Mauersteine auch rustikal verbaut werden. Eine weitere Alternative für Mauersteine sind Quaderblöcke, diese werden ebenfalls mit Pressluftbohrern und Spaltkeilen erstellt, wiegen aber ab 200 kg aufwärts und sind somit nur mit Bagger und Hebezange zu versetzen.

#WirImGaLaBau
Nachhaltig soll es sein, naturnah und lebendig. Nicole Frank und Frank Schroeder arbeiten vom Ommertalhof aus mit lokaler Grauwacke, Recyclingmaterialien und ganz vielen Pflanzen. Sie teilen sich die Arbeit nach den Kriterien „Spaß muss es machen" und „zum Leben muss es reichen" ein und zeigen damit einen GaLaBau, der im Hinblick auf Gestaltung und Betriebsführung so ganz anders ist als der Durchschnitt.
Weitere Beiträge und Informationen finden Sie hier.
Gartenmanufaktur Schroeder
Firmengründung: 10/1990
Gesellschaftsform: GbR
Inhaber: Frank Schroeder
Kontakt
Ommertalhof | Gartenmanufaktur und Landschaftsbau
Frank Schroeder, Gärtnermeister
Zur Ommer 9, D-51789 Lindlar
Telefon 02266/47 15 37

Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen

















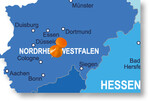













Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.